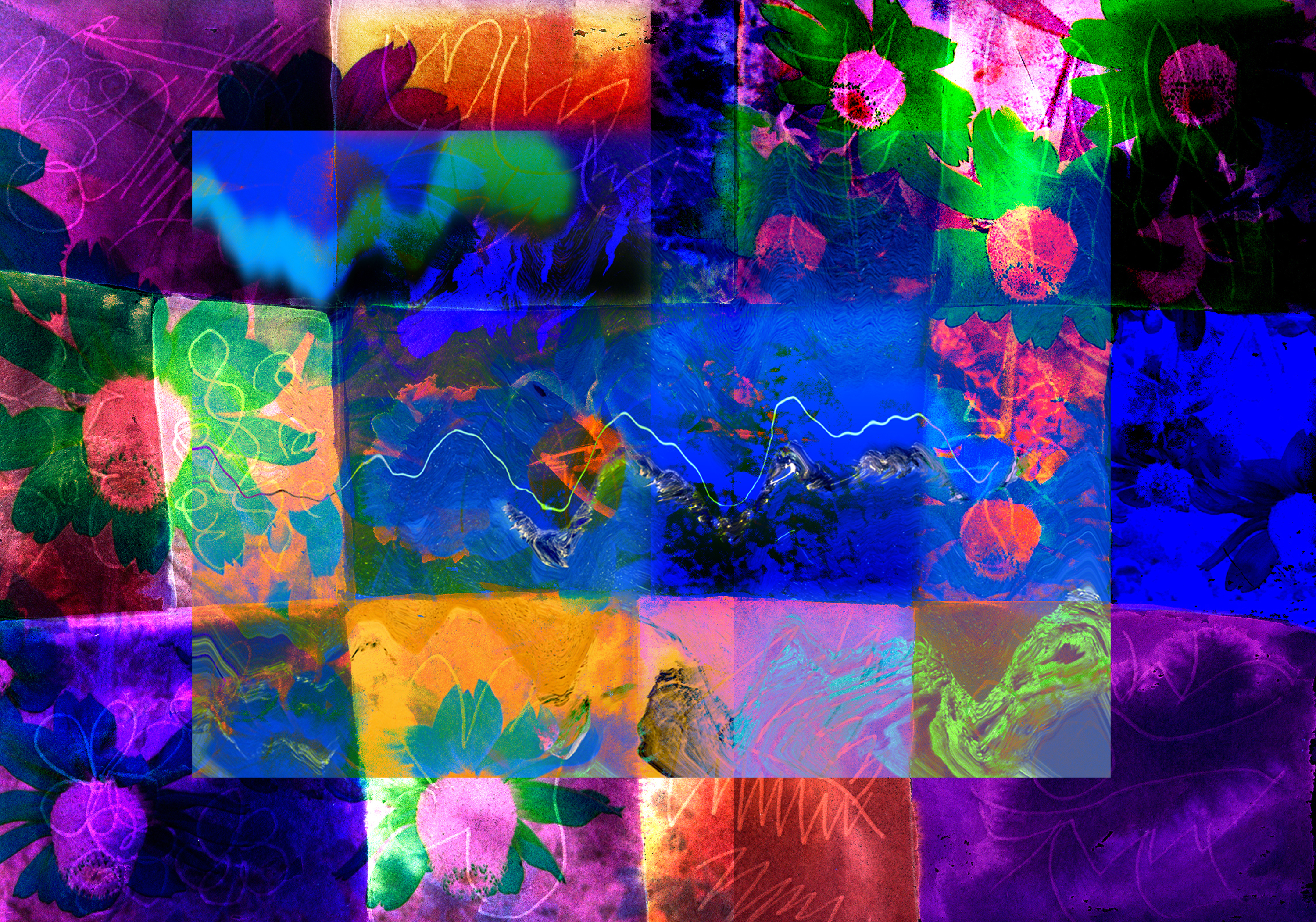Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl!
Was genau ist an der Psychotherapie eigentlich therapeutisch?
Von Guido Plata
Die Antwort auf die Frage in der Überschrift scheint naheliegend: „Natürlich die vom Therapeuten eingesetzten Techniken, die führen schließlich die gewünschte Veränderung herbei.“ Diese oder ähnliche Antworten kommen vielen Menschen spontan in den Sinn, aber denken Sie einmal über Folgendes nach: Könnte man ein und denselben Klienten theoretisch zu zehn verschiedenen Therapeuten schicken, und das Ergebnis der Behandlung wäre in allen Fällen dasselbe?
Nein, sicher nicht, meint man nun, da müsste es doch Unterschiede geben – aber warum sieht man dies so? Weshalb geht man davon aus, dass sich die Ergebnisse unterscheiden würden?
Jeder Mensch weiß aus Erfahrung, dass alle Vorgänge im Leben durch viele Faktoren beeinflusst werden können. Eine Psychotherapie ist keine Ausnahme von dieser Regel; der Verlauf und das Ergebnis einer Therapie sind unzähligen Einflüssen unterworfen.
Betrachten wir einmal genauer, welche Einflüsse möglich sind: Sicher gibt es oft berufliche oder private Veränderungen im Leben des Klienten, die nicht wegen der Therapie aufgetreten sind, sich aber dennoch auf die Therapie auswirken. Auch kommen einzelne Klienten und Therapeuten unterschiedlich gut miteinander aus, vielleicht beherrschen manche Therapeuten ihr Handwerk besser als andere, der besondere Stil eines bestimmten Therapeuten passt besser zu einem individuellen Klienten, oder man versteht sich besser oder schlechter. Aber ist die Beziehung zwischen Therapeut und Klient wirklich entscheidend?
Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, wie man eine Psychotherapie sieht. Versteht man sie als eine Art Reparatur, wie bei einem Auto in der Werkstatt? In diesem Fall wäre das Therapieergebnis nur vom Können des Therapeuten beim Einsatz der therapeutischen Techniken abhängig. Oder sieht man Psychotherapie eher als Prozess, an dem der Klient aktiv teilnimmt und ein gutes Verhältnis zwischen Therapeut und Klient entscheidend für den Ausgang ist? Dann hätte der zwischenmenschliche Faktor erhebliches Gewicht. Und hier kommt die therapeutische Beziehung ins Spiel.
Seit den 1940er Jahren befasst man sich in der Psychotherapieforschung mit der therapeutischen Beziehung, die als intensiver Wirkfaktor angesehen wird. Eine der am Häufigsten zitierten Schätzungen ihres Einflusses stammt von dem US-amerikanischen Psychologen Michael J. Lambert (1992), der vier grundsätzliche Faktoren mit Relevanz für den Therapieerfolg unterschied:
- Außertherapeutische Faktoren. Dies sind Faktoren im Leben des Klienten, die nicht infolge der Behandlung eintreten, sich aber darauf auswirken. Hierzu zählen die bereits erwähnten Veränderungen im Leben des Klienten (positive, wie eine Beförderung, oder negative, wie ein Trauerfall), die Voraussetzungen in der Persönlichkeit des Klienten (wie seine Ich-Stärke) und auch das Maß an sozialer Unterstützung, das er von Freunden oder Familie erhält. All diese Faktoren kann der Therapeut nicht beeinflussen, aber sie tragen entscheidend zum Erfolg der Therapie bei.
- Erwartungen. Die Erwartungen auf Seiten eines Klienten können zum Placeboeffekt führen – dem Eintreten einer positiven Veränderung, weil man glaubt, dass etwas passiert wäre, was eine positive Veränderung herbeiführen wird.
- Techniken. Die therapeutischen Techniken in der Schule, der der Therapeut angehört – wie Exposition in der Verhaltenstherapie oder kognitive Umstrukturierung in der Kognitiven Verhaltenstherapie.
- Gemeinsame Faktoren. Dies sind Faktoren, die die Beziehung zwischen Therapeut und Klient unabhängig von der theoretischen Ausrichtung des Therapeuten charakterisieren – beispielsweise Wärme, Einfühlungsvermögen, Akzeptanz, Ermutigung zum Eingehen von Risiken und andere Dinge.
Entscheidend ist nun, in welchem Ausmaß all diese Faktoren zum Therapieerfolg beitragen. Lambert (1992) schätzt die Anteile wie folgt:
- Außertherapeutische Faktoren – 40%
- Erwartungen – 15%
- Techniken – 15%
- Gemeinsame Faktoren – 30%
Bedenken Sie bei dieser Schätzung, dass genaue Angaben in Zahlen naturgemäß immer schwierig sind. Außerdem muss man beim Lesen dieser Auflistung berücksichtigen, dass alle Faktoren positiv oder auch negativ wirken können – positive Lebensereignisse fördern die Genesung, negative Lebensereignisse behindern sie. Eine gute therapeutische Beziehung ist dem Therapieerfolg zuträglich, eine schlechte therapeutische Beziehung ist ihm abträglich (und führt in vielen Fällen sogar dazu, dass die Therapie vorzeitig abgebrochen wird). Man darf die Liste also nicht so lesen, dass eine Psychotherapie insgesamt überflüssig wäre, weil ja schließlich 40 Prozent des Therapieergebnisses die Folge außertherapeutischer Faktoren seien. Vielmehr lautet die zentrale Aussage, dass das Zusammenspiel eines normalen Maßes an außertherapeutischen Faktoren mit gemeinsamen Faktoren (also einer guten therapeutischen Beziehung) und sachkundig eingesetzten Techniken zum Behandlungserfolg führt.
Die Techniken müssen dabei natürlich zu den Symptomen passen, wegen denen die Behandlung begonnen wurde – bei einer spezifischen Phobie, etwa vor Schlangen oder Spinnen, ist die Verhaltenstherapie die Methode der Wahl, bei einer chronischen Depression hingegen wären andere Therapieformen wie CBASP angebracht. Aber insgesamt gesehen macht die Art der eingesetzten Techniken an sich nur wenig vom Therapieerfolg aus. Außerdem verfolgen viele Therapeuten heutzutage einen eklektischen Ansatz, bei dem sie bei Bedarf auch Techniken aus anderen therapeutischen Schulen übernehmen, wenn sie sich als hilfreich erwiesen haben.
Insgesamt gesehen ist der heutige Stand der Therapieforschung, dass die Qualität der therapeutischen Beziehung ein entscheidender Faktor für den Therapieerfolg ist.
Was sind die Merkmale einer guten therapeutischen Beziehung? In der Literatur finden sich dazu viele Auflistungen entsprechender Eigenschaften, aber insgesamt gesehen kann man sie als freundschaftliche zwischenmenschliche Beziehung beschreiben. Sie hat Merkmale wie Wärme, Aufrichtigkeit, Einfühlungsvermögen des Therapeuten, seine Wertschätzung des Klienten und diverse andere Dinge. All dies führt dazu, dass die Beziehung auch als angenehm erlebt wird.
Die entscheidende Frage ist: Fühlt der Klient sich wohl dabei, Zeit mit dem Therapeuten in der Therapie zu verbringen? Ist es ihm angenehm, dem Therapeuten persönliche Dinge anzuvertrauen? Fühlt er sich ernstgenommen und geschätzt? Und auch wenn die Therapie unangenehme Dinge beinhaltet, wie die Konfrontation mit negativen Gedanken oder Verhaltensweisen, oder den Kontakt mit gefürchteten Objekten, fühlt er sich vom Therapeuten angemessen unterstützt?
Wie bereits erwähnt, natürlich ist eine gute therapeutische Beziehung zwar notwendig, aber für sich allein nicht hinreichend für positive Veränderungen – ebenso wenig wie der hohe Anteil außertherapeutischer Faktoren bedeutet, dass eine Psychotherapie insgesamt überflüssig wäre. Aber dennoch stellt die therapeutische Beziehung einen der Eckpfeiler des Behandlungserfolges dar, und insofern ist die Fähigkeit des Therapeuten, eine gute therapeutische Beziehung herzustellen und aufrechtzuerhalten, äußerst wichtig.
Diese letztgenannte Fähigkeit bezeichnet man in der neueren Literatur auch als therapeutische Metakompetenz, und sie hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Für Therapeuten bedeutet dies, mehr Gewicht auf „Softskills“ zu legen, und weniger auf die Anwendung bestimmter Techniken ihrer jeweiligen Schule. Auch die Haltung gegenüber dem Klienten ändert sich mit steigender Metakompetenz hin zu mehr Akzeptanz und Einfühlungsvermögen, und ebenso hin zu mehr Respekt für den kulturellen und persönlichen Hintergrund des Klienten. Gute therapeutische Metakompetenz führt dazu, dass die Behandlung beim Aufbau der therapeutischen Beziehung an den Klienten angepasst wird – der Klient ist ein gleichberechtigter Partner beim Aufbau der Beziehung, die als Vehikel für das Herbeiführen von Veränderungen dient und den entsprechenden Kontext liefert. Ebenso wird die Meinung des Klienten über seine Symptome und den therapeutischen Prozess honoriert. Der Klient selbst hat eine (wenn auch nicht wissenschaftlich formulierte) Theorie über seine Beschwerden, ihre Ursache und den eigentlichen Therapieprozess. Diese muss ernstgenommen werden, denn damit die angebotenen Techniken unabhängig von der Therapieschule funktionieren, muss der Klient bereit sein, sich darauf einzulassen. Dies wiederum setzt voraus, dass er sie nicht nur auf der abstrakten Ebene versteht und für brauchbar hält, was ja das Ziel der Psychoedukation ist. Sollte der Klient den Therapieprozess aber als herabwürdigend oder unangemessen erleben, ist ein Behandlungserfolg praktisch ausgeschlossen.
Zusammenfassend kann man also sagen: Es ist entscheidend, dem Klienten mit Achtung, Wärme und Einfühlungsvermögen zu begegnen, um bei ihm wiederum eine Haltung hervorzurufen, die eine gute therapeutische Beziehung ermöglicht. Für Therapeuten bedeutet dies, sich stärker mit der Weiterentwicklung ihrer therapeutischen Metakompetenz zu befassen, und für Klienten bedeutet es, bei der Auswahl eines Therapeuten auch einfach mal auf ihr „Bauchgefühl“ zu hören!
Über den Autor
Guido Plata ist Diplom-Psychologe und seit vielen Jahren als Fachübersetzer für psychologische Texte tätig.