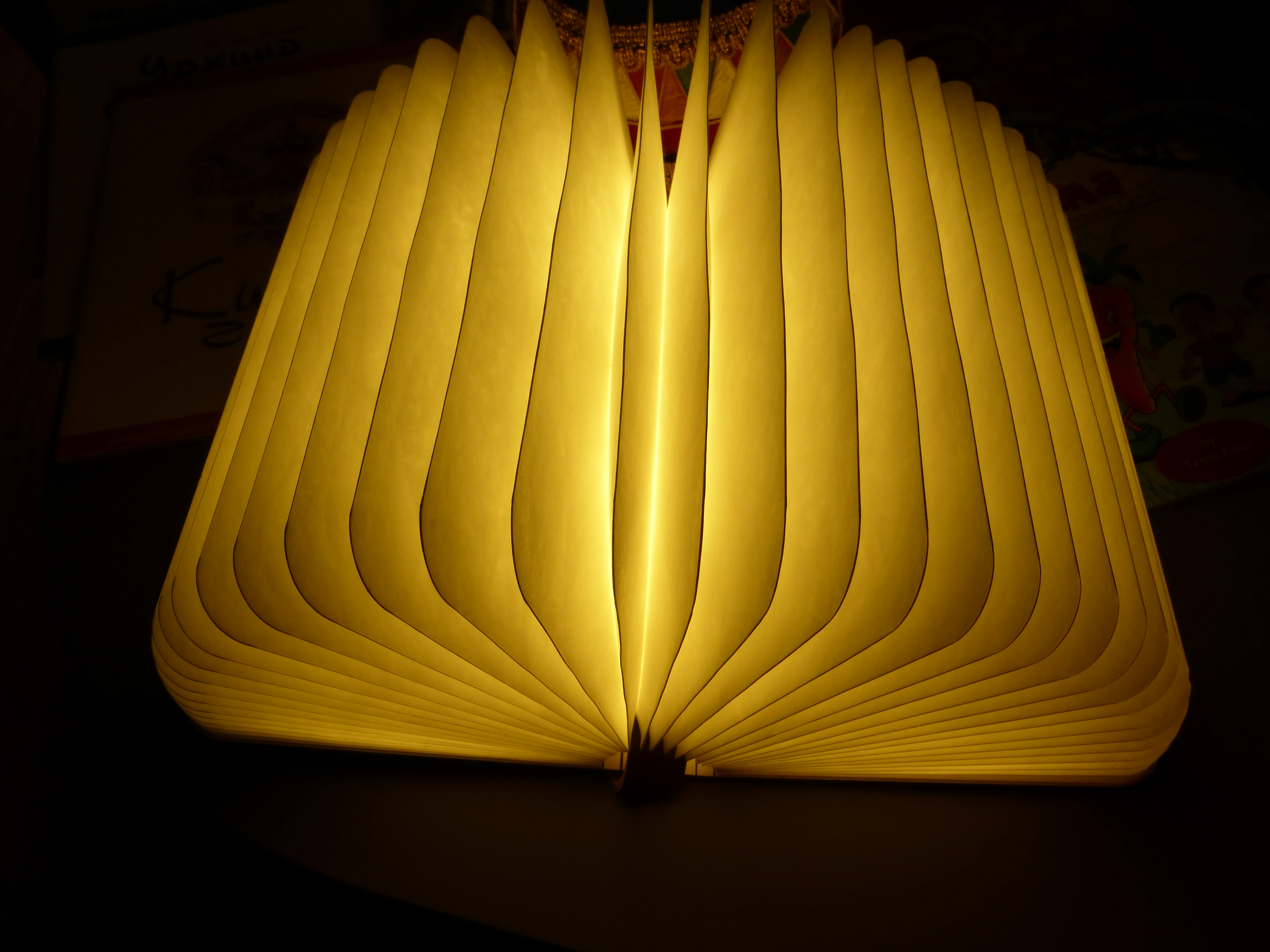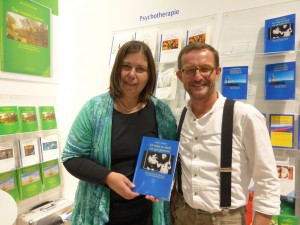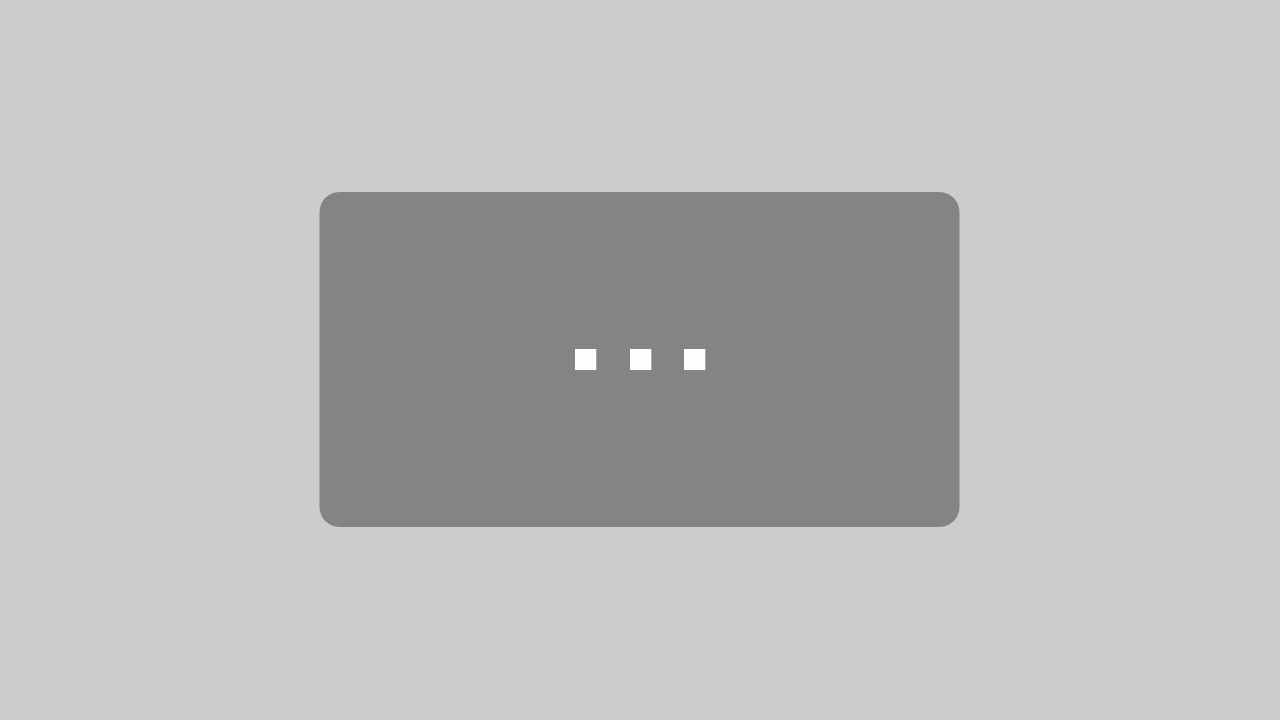Wie wir in schwierigen Zeiten unser Leben wieder auf Kurs bringen können
Von Sabine Claus
„Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.“
(Max Frisch)
Ereignisse wie die Kündigung des Arbeitsplatzes, eine nicht bestandene Prüfung, eine Trennung, Krankheit oder der Tod eines geliebten Menschen können uns vollkommen aus der Bahn werfen. Nichts ist mehr so, wie es vor dem Ereignis war.
Vielleicht durchleben auch Sie gerade eine schwierige Zeit. Vielleicht gab es ein negatives Ereignis, das Ihre bisherigen Pläne, Ziele und Wünsche beeinflusst. Vielleicht fühlen Sie sich aber auch scheinbar ganz ohne Grund energie- und kraftlos.
Die Art und Weise, wie wir ein einschneidendes Ereignis verarbeiten, ist individuell höchst unterschiedlich. Viele Menschen erleben einen Zusammenbruch, von dem sie sich über Monate oder sogar Jahre nicht erholen können. Ihre Genesung scheint blockiert. Das Leben hat an Ausrichtung verloren. Die innere Verbindung zu dem, was man sich wünscht und einem guttun könnte, ist unterbrochen. Diese Verbindung gilt es wieder herzustellen, und die große Frage lautet natürlich: Wie kann dies gelingen?
Leichter gesagt als getan: liebevoll mit sich selbst umgehen
Menschen, die gerade eine Krise durchleben, haben nicht nur mit der Situation an sich zu kämpfen, sondern vor allem mit sich selbst. Zur Tragik der Situation addiert sich die Selbst-Verurteilung. Sätze wie „Ich bin nichts mehr wert“, „Ich kriege ja gar nichts auf die Reihe“ oder „Ich falle anderen zur Last“ bestimmen ihr Denken. Doch was bewirken solche Gedanken? Bei genauerer Betrachtung erkennen wir: Sie tun weder gut, noch ermöglichen sie eine Veränderung der Situation. Selbst-Verurteilung bewirkt nur Leid oder sogar die Verschlimmerung des Leidens.
Wie wohltuend wäre es hingegen, sich in Krisenzeiten selbst eine gute Freundin, ein guter Freund zu sein? Selbst wenn es nicht danach aussieht: Hier bestehen echte Wahlmöglichkeiten! Verurteile ich mich für mein Schwachsein? Oder stehe ich mir selbst verständnisvoll bei? Die achtsame Fürsorge für sich selbst ist eine Frage des Bewusstseins und lässt sich einüben. Ein solcher liebevoller Umgang mit seinem eigenen Selbst beinhaltet beispielsweise das behutsame Erspüren eigener Bedürfnisse und Wünsche, die durch seelisches Leid verschüttet sind.
Akzeptanz der Krisensituation: der erste Schritt hinaus aus dem Tief
Wie können wir den Zugang zu unseren Wünschen wieder herstellen, wenn durch Kummer, Sorge und Schmerz alles dumpf geworden ist? Auch wenn es in solchen Zeiten paradox anmutet, kann man es nicht oft genug wiederholen: Wir haben immer die Wahl. Bestrafe ich mich selbst mit Verurteilung und Selbstanklage? Verharre ich in Erstarrung und fühle mich als Opfer der Umstände? Oder bin ich sorgsam mit mir selbst und meinen Bedürfnissen?
Es kann (und darf) einige Zeit in Anspruch nehmen, um zu der Entscheidung zu gelangen, dass sich am jetzigen bodenlosen Zustand etwas ändern soll.
Der erste Schritt besteht im Akzeptieren der momentanen Situation. Im Allgemeinen fällt es uns schwer, das Beängstigende, das Traurige, das Mutlose oder was auch immer es ist, das uns am Boden hält, anzunehmen. Es ist uns fremd. Wir wollen es nicht haben. Es macht uns Angst. Es lähmt uns. Da wir in unserer auf Tempo und Erfolg getrimmten Gesellschaft vor allem gelernt haben, Schritt zu halten und „zu funktionieren“, steht uns in schwerer Zeit wenig Orientierung zur Verfügung. Viele Menschen haben verinnerlicht, dass Schwäche und ein Gefühl des Nicht-mehr-Weiterwissens nicht zu ihnen selbst gehören dürfen. Redewendungen und Floskeln wie „Das wird schon wieder!“ oder „Ein Indianer kennt keinen Schmerz!“ werden zwar von Mitmenschen in guter Absicht ausgesprochen, bewirken jedoch meist das Gegenteil: Sie verhindern, dass wir das Schwere annehmen, und führen dazu, dass wir wegsehen, ignorieren, nur noch eine Rolle spielen und nicht mehr wir selbst sind.
Wenn wir mit der Schwere in Kontakt treten, wird es leichter
Stellen wir uns das Schwere wie eine leibhaftige Person vor, die uns sehr nahe steht. Wie würde sich diese Person fühlen, wenn wir sie nicht ernst nehmen, ignorieren oder wegdrängen würden? Es würde ihr wohl noch schlechter gehen. Sie würde vielleicht weinen und uns in der Hoffnung auf Trost hinterherlaufen. Oder sie würde resignieren, sich von uns abwenden und in uns als ungutes Gefühl und schlechtes Gewissen weiterleben. Wann würde es der Person besser gehen? Wenn wir sie in ihrem Kummer ernst nehmen würden, sie liebevoll umarmen, ihr zuhören, sie ohne gute Ratschläge trösten, einfach für sie da sein würden. Deshalb sollten wir versuchen, so viel wie möglich über das Dunkel in uns zu erfahren. Und das gelingt uns nur, wenn wir es als einen Teil von uns selbst annehmen. Als einen Teil, der uns vielleicht unbekannt ist oder uns Angst macht. Denn nur, was angenommen ist, kann wieder losgelassen werden.
Zurück ins Leben durch Klagen und Trauern
Wie aber kann uns der Umgang mit dem Schweren gelingen? Wie kann Akzeptieren aussehen? Offen ausgelebte Trauer hat in unserer Gesellschaft leider kein gutes Image. Dennoch ist es wichtig, seinen Raum für das Trauern und Klagen zu finden, um anschließend wieder frei für das Leben zu werden. Zugleich müssen wir hier bewusst eine Unterscheidung treffen: Denn Klagen oder Trauern hat nichts zu tun mit lautem oder innerlichem Jammern. „Jammern als Dauerzustand, um nichts verändern zu müssen. Jammern, um meine Verwandlungsmöglichkeiten gar nie ausschöpfen zu wollen. Jammern, um mir und anderen zu bestätigen, dass es da nichts zu machen gibt“, wie es der Theologe Pierre Stutz in seinem Buch Alltagsrituale beschreibt (Stutz, 1998, S. 54). Und er weiß: „Eine lebensfördernde Haltung steckt dagegen im Klagen.“
Zwischen Jammern und Klagen besteht ein Unterschied. Das Klagen drückt vor allem Schmerz aus, während das Jammern bzw. das Sich-Beklagen ein Ausdruck von Unzufriedenheit ist. Klagen schließt nur gelegentlich eine Schuldzuweisung mit ein, während Jammern implizit oder explizit eine Beschuldigung enthält. Beim Jammern werden andere oder eine Sache für den eigenen Missstand verantwortlich gemacht. Im Unterschied zum Jammern verfolgt das Klagen ein Ziel: Es ist ausdrucksstark und ein bewährtes System, der Trauer oder Enttäuschung Luft zu machen, um anschließend einen Schritt weiter zu gehen. Das Prinzip des Klagens: „Ich erzähle dir von meinen Sorgen, löse sie aber allein.“ Beim Jammern hingegen kann es heißen: „Ich bin so arm dran, andere oder die Umstände sind daran schuld.“ Jammern kann der Selbstdarstellung dienen, während Klagen vor allem Erleichterung schaffen soll.
Wenn wir uns das Klagen dauernd verbieten, wird es sich durch den Hintereingang wieder anschleichen. Das Grübeln wird nicht aufhören, der Kopf wird nicht frei werden. Wer hingegen bewusst klagt, nimmt das Schwere in sich und damit sich selbst in seiner Ganzheit an. Das ist die Voraussetzung dafür, auch wieder loslassen zu können.
Inseln des Klagens begünstigen das Loslassen
Bitte probieren Sie die erleichternde Wirkung des Klagens selbst aus. Stellen Sie sich hierfür z. B. eine Ihnen wohlgesonnene Person vor oder richten Sie Ihre Klagen an Gott, an eine höhere Macht oder Mutter Erde. Sprechen Sie laut und so lange, bis Sie sich „ausgeklagt“ haben. Das kann eine Minute dauern oder eine halbe Stunde oder länger. Sie werden sich anschließend erleichtert und freier fühlen. Außerdem werden Sie auch besser diejenigen Dinge erkennen können, über die Sie sich freuen oder für die Sie dankbar sind. Ihre Empfindungen werden wieder lebendiger und konturenreicher werden.
Nachfolgend finden Sie einige weitere Inspirationen, die das Annehmen des Schweren erleichtern und damit den Prozess des Loslassens begünstigen:
- Planen Sie sich bewusst Zeiten des Trauerns und des Klagens am Tag ein und gehen sie dann auch wieder zu anderen Dingen über. Diese geplanten Trauerräume helfen, zum einen der Trauer wirklich Raum zu geben und zum anderen nicht in ihr zu versinken.
- Richten Sie sich nach dem Tod eines geliebten Menschen einen Ort ein, wo ein Foto oder ein Symbol, das Sie verbindet, steht. Zünden Sie regelmäßig eine Kerze an oder stellen Sie eine Blume auf, um Ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen.
- Schauen Sie sich gemeinsam mit anderen Fotos der vergangenen Zeit an, die Sie betrauern. Weinen Sie und lachen Sie gemeinsam.
- Geben Sie bei einer Trennung oder Kündigung Gegenstände, die Sie an den Menschen oder die alte Stelle erinnern und die Sie nicht mehr bei sich haben möchten, bewusst zurück oder weg.
- Falls Sie bemerken, dass Sie nicht richtig trauern können, ihnen die Tränen versagen, obwohl sie weinen möchten, können Sie sich einem Musikstück hingeben. Es kann sehr befreiend sein, über einen bestimmten Zeitraum hinweg seinen Emotionen freien Lauf zu lassen.
Wie lange die Zeit des Klagens und Trauerns ist, die wir benötigen, um loslassen zu können, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Beim Tod eines geliebten Menschen spricht man vom Trauerjahr. Auch Krankheit, eine (berufliche oder private) Niederlage, Trennungen oder Kündigungen benötigen Zeit, um sie zu begreifen und anzunehmen. Was gerade an der Zeit ist, können nur wir selbst erspüren.
Klagen in Wünsche verwandeln, um dem Leben wieder Richtung zu geben
Nur Sie allein wissen, wann der richtige Moment gekommen ist, um einen neuen Schritt zu gehen. Wenn wir merken, dass sich in schwerer Zeit etwas in uns regt, können wir über unser Klagen eine neue Verbindung zu unseren inneren Wünschen herstellen. Denn hinter jeder Klage liegt auch ein Wunsch verborgen.
Wenn wir eine schwere Krankheit beklagen, verbirgt sich dahinter vielleicht der Wunsch, einen tieferen Sinn darin zu erkennen. Wenn wir den Tod eines geliebten Menschen beklagen, entsteht vielleicht nach einer Phase des Trauerns der Wunsch, die gemeinsam verbrachte Zeit in dankbarer Erinnerung zu bewahren. Wenn wir eine Trennung beklagen, könnte es sein, das sich nach einer gewissen Zeit der Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung in uns regt. Wer den Verlust seines Arbeitsplatzes beklagt, der aufgrund einer Umstrukturierung wegrationalisiert wurde, wünscht sich neben der Sicherung seiner materiellen Existenz vielleicht auch mehr Einflussmöglichkeiten und eigene Gestaltungsspielräume.
Manchmal benötigt es auch (professionelle) Hilfe, um diese Verbindung zu den eigenen Wünschen wieder herstellen, um wieder in einen liebevollen Dialog mit sich selbst treten zu können. Suchen Sie sich diese Unterstützung, denn Sie tragen die Verantwortung für sich!
Die Chance in schwerer Zeit: mit uns selbst vertrauter werden
Die Zeit des Trauerns und Klagens trägt demnach die große Chance in sich, uns mit unseren tiefsten Wünschen noch vertrauter zu machen, uns selbst noch besser kennenzulernen und unser Leben neu ausrichten zu können.
Um die Wünsche hinter unserem Klagen zu erfassen, können wir zunächst unsere Klagen aussprechen und aufschreiben.
„Ich beklage, dass … Außerdem beklage ich, dass …“
Anschließend können wir vorsichtig und aufrichtig versuchen, unsere tiefen und wahren Wünsche zu ergründen, die hinter jeder Klage verborgen sind.
„Ich beklage, dass … und zugleich wünsche ich mir …“
Diese Arbeit kann sehr intensiv sein. Möglicherweise führt sie uns sehr nah zu uns selbst und auf den Grund unserer Seele.
Man könnte sich eine Liste mit den Wünschen, die sich hinter unseren Klagen verstecken, anlegen. Nach und nach sollten wir prüfen, welche dieser Wünsche wir loslassen möchten oder vielleicht sogar müssen. Alles, was unerfüllbar oder unwiederbringlich verloren ist, und alles, was uns noch daran bindet, dürfen wir loslassen. Um den Prozess des Loslassens zu erleichtern, bietet sich ein Ritual an, z. B. das Verbrennen der aufgeschriebenen unerfüllbaren Wünsche auf Papier oder auf Holz.
Ein belgisches Sprichwort kann beim erneuten Prüfen unserer Wunschliste hilfreich sein: „Die hilfreichste Hand hängt an deinem eigenen Arm.“ Welchen Wunsch können wir uns aus eigener Kraft erfüllen? Die Erfüllung welchen Wunsches wäre realistisch? Die Erfüllung welchen Wunsches würde das Leben erhellen und vielleicht sogar glücklich machen?
Nun geht es darum, den ersten Schritt zu tun. Sich selbst einen kleinen Wunsch zu erfüllen ist der erste Schritt raus aus dem Tief, zurück in ein selbstbestimmt und bewusst geführtes Leben.
Mehr zum Thema Wunscherfüllung können Sie in „Mein allerbestes Jahr – Ziele erreichen, dem Leben Richtung geben“ lesen, das ab dem 23. Oktober 2015 im Handel erhältlich ist.
Haben Sie direkt Fragen? Oder Anmerkungen, was Ihnen dabei geholfen hat, schwere Zeiten zu meistern? Dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf einen Austausch.
 Über die Autorin
Über die Autorin
Sabine Claus ist Master of Advanced Studies in Coaching & Organisationsberatung und Dipl. Betriebswirtin (BA). Seit 1998 im Berufsleben stehend und seit 2001 als Beraterin tätig, hat sie mehr als 5000 Menschen in rund 100 Organisationen begleitet. Sie hilft Teams in Veränderungsprozessen und unterstützt Menschen in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter www.sabineclaus.ch oder www.meinallerbestesjahr.ch.
 Praxis, Sounder Sleep System-Senior Teacher, Dozentin in der kollegialen Fortbildung und Erwachsenenbildung im Gesundheitsbereich sowie in der betrieblichen Gesundheitsförderung.
Praxis, Sounder Sleep System-Senior Teacher, Dozentin in der kollegialen Fortbildung und Erwachsenenbildung im Gesundheitsbereich sowie in der betrieblichen Gesundheitsförderung.