3 x 3 Tipps für den Umgang mit Herausforderungen im Online-Coaching – Teil 2
Von Karin Kiesele und Andrea Schlösser
Herausforderung 2: Ich kann online nicht visualisieren
In der Online-Arbeit stehen wir tatsächlich vor der Herausforderung, für visuelle Impulse zu sorgen und unsere Methodik nachhaltig sichtbar zu machen. Für einige Methoden bedeutet das scheinbar: Aufgrund mangelnder Visualisierungsmöglichkeiten können wir sie leider nicht nutzen. Wirklich? Wenn wir uns mental darauf einlassen können, neue Wege zu gehen, rücken zahlreiche Methoden doch wieder in den Bereich des auch online Machbaren.
Tipp 1: Erste Hilfe für spontanes und schnelles Visualisieren: Alles, was Sie brauchen sind Papierbögen und Marker. Zeichnen Sie auf, was Sie visualisieren wollen, halten Sie Ihr Blatt in die Kamera und besprechen mit Ihrem Klienten die Visualisierung. Anschließend können Sie ihm auch noch ein Foto der Visualisierung zuschicken.
Natürlich können Sie auch, falls vorhanden, ein Flipchart nutzen. Platzieren Sie es so, dass es gut im Bild ist und arbeiten Sie wie gewohnt damit.
Tipp 2: Falls Ihr Videokonferenzsystem über eine Whiteboard-Funktion verfügt, können Sie diese natürlich gut für Visualisierungen nutzen. Ebenfalls (oder alternativ) können Sie die Chat-Funktion als Visualisierungshilfe hinzuziehen. Diese eignet sich z.B. sehr gut, um Lösungsideen zu sammeln.
Beispiel: „Was können Sie tun, um gut für sich selbst zu sorgen?” – Bitten Sie Ihren Klienten, seine Ideen in den Chat schreiben. Gemeinsam sammeln Sie so die Antworten, die Sie im Nachgang leicht protokollieren können, indem Sie den Chatverlauf speichern oder kopieren.
Tipp 3: Bereiten Sie Text-Dokumente vor und teilen Sie diese während des Online-Coachings über die Funktion „Bildschirm teilen“. So können Sie gemeinsam mit Ihrem Klienten die Inhalte bearbeiten.
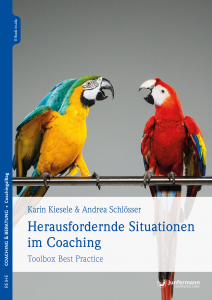 Nicht nur online begegnen uns als Coaches eine Vielzahl an Herausforderungen. Auch im Direktkontakt gibt es mitunter Situationen, die uns an Grenzen bringen. Genau auf solche Momente gehen wir in unserem neuen Buch Herausfordernde Situationen im Coaching ein, das im Sommer 2020 erscheinen soll. Damit bieten wir Coaches einen strukturierten und praxisnahen Ratgeber für den Coachingalltag. Das Buch zeigt eine Fülle konkreter Handlungsanleitungen auf, die Coaches helfen, mit Herausforderungen umzugehen.
Nicht nur online begegnen uns als Coaches eine Vielzahl an Herausforderungen. Auch im Direktkontakt gibt es mitunter Situationen, die uns an Grenzen bringen. Genau auf solche Momente gehen wir in unserem neuen Buch Herausfordernde Situationen im Coaching ein, das im Sommer 2020 erscheinen soll. Damit bieten wir Coaches einen strukturierten und praxisnahen Ratgeber für den Coachingalltag. Das Buch zeigt eine Fülle konkreter Handlungsanleitungen auf, die Coaches helfen, mit Herausforderungen umzugehen.
 Karin Kiesele, Kommunikationswissenschaftlerin (B. A.), zertifizierter Personal & Business Coach, zertifizierte Trainerin, NLP Practitioner, Resilienztherapeutin, Mitglied im Deutschsprachigen Dachverband für Positive Psychologie e. V.
Karin Kiesele, Kommunikationswissenschaftlerin (B. A.), zertifizierter Personal & Business Coach, zertifizierte Trainerin, NLP Practitioner, Resilienztherapeutin, Mitglied im Deutschsprachigen Dachverband für Positive Psychologie e. V.
www.karin-kiesele.de
www.worteundtaten.net
 Andrea Schlösser, Coach und Supervisorin DGSv, Mediatorin BM, zertifizierte Trainerin, NLP Master
Andrea Schlösser, Coach und Supervisorin DGSv, Mediatorin BM, zertifizierte Trainerin, NLP Master
www.andrea-schloesser.de
www.neurolines.de
2018 erschien ihr gemeinsames Buch Job-Coaching bei Junfermann.
NLP und mehr: Klaus Grochowiak (27.10.1950 – 13.04.2020)
Wir erhielten die traurige Nachricht, dass unser Autor Klaus Grochowiak am Ostermontag im Alter von 69 Jahren verstorben ist. Im Zeitraum von 1995 bis 2002 erschienen bei Junfermann insgesamt sieben Bücher von ihm.
In den 1990er-Jahren wurde NLP in Deutschland ganz groß, und dazu passten auch die beiden kapitalen, von Klaus Grochowiak verfassten DIN-A4-Bände: zuerst das „NLP Practitioner Handbuch“ und später dann das „NLP Master Handbuch“. Hier versammelte sich das Wissen, das er in den Ausbildungsgängen an seinem eigenen Institut, der Creative NLP Academy (CNLPA) vermittelte. Und wie fundiert dieses Wissen war, zeigt allein ein kurzer Auszug aus seiner Autorenbiografie, wie sie auf den Büchern erschien:
„Klaus Grochowiak ist Master-Trainer der INLPTA (Wyatt Woodsmall), Certified Trainer der Society of Neuro-Linguistic Programming (Bandler & Associates), Certified Trainer der NLP Connection (Chris Hall).“
Bereits sein Werdegang vor Gründung der CNLPA macht deutlich: Hier ist jemand, der alles andere als eingleisig durchs Leben fährt. Er studierte Politikwissenschaften, Philosophie und mathematische Logik. Seine Diplomarbeit hatte folgenden Titel: „Die Kontext-Wert-Logik als formales Modell der Modellierung der Ware-Geld-Beziehung bei Marx“. Anschließend war er einige Jahre als Broker tätig und kam danach in Berührung mit dem NLP.
Wenn ich mir die bei Junfermann erschienenen Grochowiak-Bücher anschaue, dann fällt eines auf: Bis auf die beiden o.g. Handbücher wurden alle anderen mit unterschiedlichen Co-Autorinnen und -Autoren mit Expertise in unterschiedlichsten Gebieten verfasst. Sie behandeln Themen wie Selbstmotivation, Selbst- und Weltmodelle, Veränderungsarbeit, kommunikative Kompetenz oder Familienaufstellungen. Hier zeigt sich die Bandbreite der Interessen und die Weite von Klaus Grochowiaks Denken. Und so sieht auch DVNLP-Vorstandsmitglied Ralf Dannemeyer sein vielleicht größtes Verdienst für die Idee des NLP in der „Verknüpfung unserer Disziplin mit neuesten Erkenntnissen der Neurowissenschaften, des menschlichen Energiesystems und der systemischen Aufstellungsarbeit“.
Wir haben als Verlag Klaus Grochowiaks großes Wissen und seine Expertise auf unterschiedlichsten Gebieten immer geschätzt. Auch wenn seine letzte Buchveröffentlichung bei Junfermann bereits einige Zeit zurückliegt: Für die vielen Jahre der produktiven Zusammenarbeit sind wir ihm zu großem Dank verpflichtet.
3 x 3 Tipps für den Umgang mit Herausforderungen im Online-Coaching – Teil 1
Von Karin Kiesele und Andrea Schlösser
Herausforderung 1: Meine Lieblingsmethode kann ich online nicht umsetzen
Tatsächlich sind einige Methoden online kaum möglich, etwa psychodramatisches Arbeiten oder Elemente aus dem wingwave Coaching. Wenn es Ihnen jedoch gelingt, sich im Kopf frei zu machen und kreativ zu werden, dann erkennen Sie: Zahlreiche andere gestalterische Methoden lassen sich erstaunlich gut auch online umsetzen.
Das gilt auch für die Arbeit mit Bodenankern und Trancen; im Online-Coaching lassen sie sich ohne große Probleme gut umsetzen. Hierzu drei praktische Tipps:
Tipp 1: Für die Arbeit mit Bodenankern schicken Sie ihrem Klienten Moderationskarten zu und bitten Sie ihn, diese für die Arbeit in der später folgenden Online-Session bereit zu legen.
Tipp 2: Bereiten Sie Arbeitsblätter vor, die analog zu Ihrer Lieblingsmethode aufgebaut sind. Erklären Sie das Vorgehen schrittweise und lassen Sie genügend Platz frei, damit der Klient seine Impulse, Antworten oder Ideen eintragen kann. So lassen sich z.B. Methoden zur Arbeit mit der Timeline, Skalierungsfragen oder auch die Arbeit zum Wertesystem des Klienten gut umsetzen.
Tipp 3: Schauen Sie, ob es Fragebögen, Checklisten oder Tests zu Ihrer Methode gibt, die der Klient selbst ausfüllen kann. Beispiel: Wir bieten im Downloadbereich zu unserem Buch Job-Coaching einen Test zu den Karriereankern nach Ed Schein an. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass es zu Ihrer Methode ebenfalls geeignete Tools gibt. Die Ergebnisse können Sie dann online gut gemeinsam mit Ihrem Klienten besprechen.
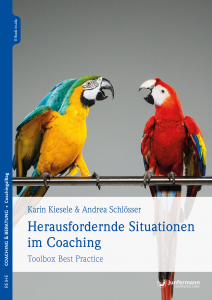 Nicht nur online begegnen uns als Coaches eine Vielzahl an Herausforderungen. Auch im Direktkontakt gibt es mitunter Situationen, die uns an Grenzen bringen. Genau auf solche Momente gehen wir in unserem neuen Buch Herausfordernde Situationen im Coaching ein, das im Sommer 2020 erscheinen soll. Damit bieten wir Coaches einen strukturierten und praxisnahen Ratgeber für den Coachingalltag. Das Buch zeigt eine Fülle konkreter Handlungsanleitungen auf, die Coaches helfen, mit Herausforderungen umzugehen.
Nicht nur online begegnen uns als Coaches eine Vielzahl an Herausforderungen. Auch im Direktkontakt gibt es mitunter Situationen, die uns an Grenzen bringen. Genau auf solche Momente gehen wir in unserem neuen Buch Herausfordernde Situationen im Coaching ein, das im Sommer 2020 erscheinen soll. Damit bieten wir Coaches einen strukturierten und praxisnahen Ratgeber für den Coachingalltag. Das Buch zeigt eine Fülle konkreter Handlungsanleitungen auf, die Coaches helfen, mit Herausforderungen umzugehen.
 Karin Kiesele, Kommunikationswissenschaftlerin (B. A.), zertifizierter Personal & Business Coach, zertifizierte Trainerin, NLP Practitioner, Resilienztherapeutin, Mitglied im Deutschsprachigen Dachverband für Positive Psychologie e. V.
Karin Kiesele, Kommunikationswissenschaftlerin (B. A.), zertifizierter Personal & Business Coach, zertifizierte Trainerin, NLP Practitioner, Resilienztherapeutin, Mitglied im Deutschsprachigen Dachverband für Positive Psychologie e. V.
www.karin-kiesele.de
www.worteundtaten.net
 Andrea Schlösser, Coach und Supervisorin DGSv, Mediatorin BM, zertifizierte Trainerin, NLP Master
Andrea Schlösser, Coach und Supervisorin DGSv, Mediatorin BM, zertifizierte Trainerin, NLP Master
www.andrea-schloesser.de
www.neurolines.de
2018 erschien ihr gemeinsames Buch Job-Coaching bei Junfermann.
Stimulation, Anerkennung und Struktur? Corona schränkt die Möglichkeiten unserer Bedürfnisbefriedigung erheblich ein
Passen Sie auf sich auf!
Von Andrea Landschof
Selbstfürsorge ist in Zeiten des Coronavirus wichtiger denn je. Prinzipiell geht es jetzt darum, sich auf das zu konzentrieren, was man selbst in der Hand hat, statt auf das, was man nicht beeinflussen kann. In diesem Zusammenhang spielen unsere individuellen Bedürfnisse eine große Rolle. Neben den existenziellen Grundbedürfnissen wie zum Beispiel Nahrung und Schlaf benötigen wir Menschen die Befriedigung weitreichenderer Bedürfnisse, um ein gesundes Leben führen zu können. Die Transaktionsanalyse geht von angeborenen psychologischen Grundbedürfnissen aus, die entwicklungsfördernde und sozial regulierende Funktionen erfüllen. Sie werden auch als „Hunger“ des Menschen nach Stimulation, nach Anerkennung und nach Zeitstrukturierung bezeichnet. Wir fühlen uns in der Regel erst dann wohl, wenn dieser Hunger genügend Beachtung findet und gestillt ist.
In Zeiten von Corona werden die Möglichkeiten, unsere existenziellen Grundbedürfnisse zu befriedigen, jedoch stark eingeschränkt. Direkte Zuwendung über Kontakt und Beziehung ist nur noch zum Teil möglich. Wir sind aufgefordert, uns im privaten und beruflichen Leben neue Ordnungssysteme und Strukturen zu schaffen. Beispielsweise im Homeoffice oder bei der Betreuung der Kinder, die derzeit nicht mehr in Schule oder Kindergarten gehen und auch die Großeltern nicht besuchen dürfen.
Alte und bewährte Formen von (sinnlicher) Anregung brechen weg und fordern uns heraus, neue Wege der sensorischen Anregung zu finden.
Das Grundbedürfnis nach sinnlicher Anregung
Wir Menschen benötigen für unser Überleben die Anregung unserer Sinne. Im heutigen Zeitalter der Reizüberflutung gibt es meist ein Zuviel, eine Überstimulation unserer Sinne, die zu Stress führen kann. Mit dem plötzlichen Wegfall von Arbeits- und Vereinsleben und weiteren Freizeitaktivitäten wie Kino und sommerlichen Grillabenden mit Freunden etc. konzentriert sich das soziale Leben noch mehr als sonst auf die digitale Welt. Das schafft weitere Herausforderungen. Wir sind aufgefordert, ein für uns und unser Leben passendes Maß zu finden – auch oder gerade jetzt während der Corona-Situation.
Fühlen Sie sich eingeladen, einmal darüber nachzudenken, wie viel und welche Art von Stimulation Sie wirklich benötigen. Was ist möglich – trotz Corona?
Wie stillen Sie aktuell Ihr Grundbedürfnis nach sinnlicher Anregung? Wie steht es um Ihr Bedürfnis nach Ruhe und Ausgleich? Möglicherweise tut es Ihnen in dieser Zeit gut, nicht mehr so viele Termine und reale Kontakte zu haben. In der Stille, beispielsweise in Form eines langen Spaziergangs in der Natur, finden Sie die Art von sinnlicher Anregung, die Sie brauchen. Kramen Sie auch gerne in Ihrer „Kindheitstruhe“. Was haben Sie damals gern getan, und wie haben Sie es sich gut gehen lassen? Haben Sie gemalt, musiziert oder gewerkelt? Was benötigen Sie, um sich lebendig zu fühlen? Vielleicht gehören Sie zu den Menschen, die lieber mit anderen in Kontakt stehen und sich durch gemeinsame Gespräche oder Unternehmungen zu zweit geistig anregen lassen?
Das Grundbedürfnis nach Anerkennung
Als soziale Wesen haben wir ein angeborenes Bedürfnis nach Zugehörigkeit und streben danach, von anderen Menschen wahrgenommen zu werden.
Der Transaktionsanalytiker Eric Berne spricht von „Strokes“ und bezeichnet damit eine sogenannte Anerkennungseinheit: Wir zeigen anderen (verbal oder nonverbal), dass wir deren Gegenwart beachten. Stroken beinhaltet nicht, dass wir unser Gegenüber körperlich berühren oder streicheln (obwohl auch das in manchen Fällen sehr wohltuend sein könnte, nur momentan eben nicht immer möglich ist), sondern beinhaltet auch andere Formen der „Zuwendung“, die wir einander schenken, etwa ein freundliches „Guten Morgen“ zur Begrüßung.
Gehen Sie bewusst mit Zuwendung um:
- Geben Sie Zuwendung, wenn Sie gern möchten! Rufen Sie einen Freund/eine Freundin an oder gehen Sie gemeinsamen (unter Einhaltung des notwendigen Abstands) spazieren und teilen Sie der Person mit, was Sie an ihr schätzen. Wer benötigt in Zeiten von Corona Ihre Hilfe und ermutigende Worte oder Taten?
- Geben Sie sich selbst Zuwendung! Was gelingt Ihnen gut trotz der Herausforderungen dieser Zeit? Wie meistern Sie die Ausnahmesituation? Worauf können Sie stolz sein? Sind Sie nicht täglich der Held/die Heldin Ihres Alltags?
- Nehmen Sie Zuwendung an, wenn Sie welche möchten! Wir sind als beziehungsorientierte Wesen aufeinander angewiesen. In diesen Zeiten mehr als je zuvor. Nehmen Sie die Hilfe an, wenn Sie sie brauchen. Von Ihrem Nachbarn, der für Sie einkaufen geht. Von der Freundin, der Sie Ihr Leid wegen der erkrankten Mutter klagen dürfen. Oder von dem Ihnen unbekannten Menschen auf der Straße, der Ihnen ein Lächeln schenkt …
- Bitten Sie um Zuwendung, wenn Sie welche benötigen! Wir alle haben unsere Ängste. Vor einer ungewissen Zukunft. Vor Krankheit. Vor dem Alleinsein oder der sozialen Isolation. Welche Form von Zuwendung täte Ihnen jetzt gut? Von wem können Sie diese erfahren?
- Lehnen Sie Zuwendung ab, wenn Sie sie nicht wollen! Nicht von jedem und nicht in allen Situationen benötigen Sie im Augenblick Unterstützung. Vieles bewegen Sie tatkräftig auch allein. Welche Hilfsangebote wollen Sie ablehnen, weil sie unpassend oder unangemessen sind?
Es geht nicht darum, dass Sie eine bestimmte Menge an Zuwendungen bekommen oder geben müssen, um gut zu leben. „Viel“ ist nicht gleichbedeutend mit „gut“. Manch einer kommt mit weniger Zuwendung aus, kann diese jedoch ausgiebig genießen. Nehmen Sie sich Zeit und überlegen Sie sich, wie es für Sie stimmig ist.
Das Grundbedürfnis nach Struktur
Jeder Mensch trägt das Bedürfnis nach innerer und äußerer Ordnung in sich.
Dieses Bedürfnis zeigt sich uns besonders dann, wenn uns, wie aktuell in diesen Corona-Zeiten, Struktur fehlt. Altbewährte Muster, Routinen und Rituale brechen weg. Obwohl viele eine Sehnsucht nach Veränderung in sich tragen, scheuen sie gleichzeitig die damit verbundenen Unsicherheiten, denn ihre Angst vor dem Unbekannten ist groß. Der „Hunger nach Struktur“ und das Bedürfnis nach Ordnung sind je nach Persönlichkeit und abhängig von Lebensabschnitten, in denen wir uns befinden, unterschiedlich stark ausgeprägt.
Ein Zuviel an Strukturvorgaben kann ebenso destruktiv für Menschen und Organisationen sein wie ein Zuwenig. Überreglementierung und Starrsinn sind die Gegenspieler, die durch die Überbetonung von Strukturen eintreten.
Menschen tragen eine natürliche Motivation in sich, auch ihre Zeit strukturieren und sinnvoll gestalten zu wollen. Es gibt nach Berne sechs unterschiedliche Arten, wie Menschen ihre Zeit und ihr Miteinander verbringen:
- durch Rückzug
- durch Rituale
- durch Zeitvertreib
- durch Aktivitäten
- durch psychologische Spiele
- durch offene Begegnungen
Die Art und Weise, wie wir unsere Zeit gestalten, beschreibt also, wie wir unser Sozialverhalten und unsere innere und äußere Welt organisieren.
- Rückzug. Gemeint ist ein psychisches oder physisches Sichzurücknehmen, an dem andere Menschen keinen Anteil haben. Wir schaffen uns Freiräume, die uns zur Regeneration dienen, beispielsweise vor uns hin träumen, etwas lesen, schlafen oder spazieren gehen. Anregung zur Selbstreflexion: Gönnen Sie sich ausreichend Auszeiten? Wie sehen Ihre Freiräume in Zeiten von Corona aus?
- Rituale. Rituale sind sinnstiftend und geben Sicherheit. In Zeiten von persönlichen und beruflichen Veränderungen sorgen Rituale für Beruhigung und Stabilität.
Anregung zur Selbstreflexion: Wie passen Ihre Rituale zu Ihrer aktuellen Lebenssituation? Welche Rituale schätzen Sie und wollen Sie in Zeiten der Veränderung beibehalten, damit Sie sich wohlfühlen? Welche davon missfallen Ihnen und sollten deshalb verändert werden?
- Zeitvertreib. Unter dem Begriff Zeitvertreib subsumiert man alle Tätigkeiten, die man zur eigenen Unterhaltung ausführt. Zeitvertreib gestaltet sich unbefangen und zweckfrei. Es müssen keine „schwerwiegenden“ Themen gehoben werden. Eine „Seinsart“, die vielen Menschen inzwischen verloren gegangen zu sein scheint: einfach in der Zeit verweilen. Anregung zur Selbstreflexion: Welchen Impulsen folgen Sie gerne? Welchen Impulsen folgen Sie, wenn Sie Langeweile haben? Kennen Sie noch zweckfreie Zeiten und können Sie sich in diesen bewegen oder etwas mit der Zeit und sich anfangen? Welchem wohltuenden Zeitvertreib können Sie gerade wegen der Corona-Beschränkungen nachgehen?
- Aktivitäten. Wir gestalten unsere Zeit mit Aktivitäten, die produktiv und gewinnbringend für uns und andere sein können. Wir erhalten durch Aktivitäten Anerkennung und Informationen. Wir gehen einer Arbeit oder einem Hobby nach, treiben Sport oder interessieren uns für Kultur oder Politik. Wir engagieren uns in Ehrenämtern und reisen durch die Welt. Vieles davon ist momentan nicht mehr möglich.
Anregung zur Selbstreflexion: Mit welchen Aktivitäten verbrachten Sie bisher Ihre Zeit, und mit welchen jetzt? Was wiederholen Sie wie häufig und zu welchen Zeiten? Was ist noch möglich?
- Psychologische Spiele. Kommunikationsweisen, durch die wir uns und andere in typische (meist dysfunktionale) Gesprächs- und Beziehungsmuster „hineinmanipulieren“, nennt die Transaktionsanalyse „psychologische Spiele“. Sie sind ineffektive Formen der Zeitgestaltung, in der die Beteiligten von verborgenen Motiven beherrscht werden. Psychologische Spiele ähneln einem kindlichen Spiel in dem Sinne, als dass sie einem immer gleichen Ablauf folgen. Der Unterschied liegt darin, dass ein kindliches Spiel immer positiv ausgerichtet ist.
Wenn wir beispielsweise mit einer bestimmten Person immer wieder in Streit geraten oder Konflikte ausfechten, kann das ein Zeichen dafür sein, dass wir uns gerade in einem solchen „Spiel“ befinden.
Anregung zur Selbstreflexion: Welche „Spiele spielen“ Sie unbewusst immer wieder? Zu welchen Spielen werden Sie in dieser beispielslosen Zeit immer wieder „eingeladen“? Und zu welchen Spielen laden Sie ein?
- Intimität. Sie ist eine echte menschliche Begegnung, die frei von Spielen ist. Wir stehen in einem authentischen Kontakt mit unseren Mitmenschen und in einer offenen Atmosphäre, die es erlaubt, wir selbst zu sein. Wir tauschen Gefühle, Gedanken und Erfahrungen aus, ohne verletzt oder manipuliert zu werden.
Anregung zur Selbstreflexion: Mit welchen Menschen teilen Sie diese Form von Intimität? Wie gestalten Sie diese? Wie können Sie in Zeiten von Corona auch über eine Entfernung hinweg Intimität mit ausgewählten Menschen herstellen?
Nutzen Sie Ihre Ressourcen und kommen Sie gut durch diese herausfordernde und auch Chancen bietende Zeit!
Herzlichst
Über die Autorin:
Andrea Landschof ist Transaktionsanalytikerin, Lehrsupervisorin und Lehrcoach. Als Inhaberin des Beraterwerkes Hamburg, einem Institut für Fort- und Weiterbildung von Berater*innen und Transaktionsanalytiker*innen, begleitet sie seit über 25 Jahren Menschen bei der beruflichen Orientierung.
Weitere Impulse zur Erfüllung unserer psychologischen Bedürfnisse sowie zu (noch) nicht genutzten Chancen und Potenzialen finden Sie in ihrem Buch Das bin ich!? Verborgene Talente entdecken und Veränderungen gestalten.
„Bleiben Sie zu Hause! Gehen Sie spazieren!“
In der Corona-Zeit erlebt das Spazierengehen einen wahren Boom. Wie heilsam und kreativitätssteigernd das „Frische-Luft-Schnappen“ sein kann, darüber hat die Schweizer Autorin Sabine Claus ein Buch geschrieben.
Ende 2019 erschien bei Junfermann der Titel Auf dem Weg. 20 Spaziergänge für das seelische Wohlbefinden. Das Thema wirkte noch vor wenigen Wochen etwas aus der Zeit gefallen. Doch das hat sich mit Corona schlagartig geändert. Heute zum virusüberschatteten Frühlingsbeginn erlebt Spazierengehen eine ungeahnte Renaissance. Die erblühende Natur weckt die Sehnsucht, draußen zu sein. Neben Joggern sieht man dieser Tage ungewöhnlich viele Menschen, die spazierend dem häuslichen Exil und dem Homeoffice entfliehen. Bewegungsfreiheit ist zum wertvollen Gut geworden. Ein Blick ins Buch von Sabine Claus verrät, warum ein einfacher Spaziergang unmittelbar belebend wirkt.
Spazieren als Notwendigkeit in Zeiten der Krise
Spazieren geht man aus Freude am Gehen ohne räumliches Ziel. Die leichte rhythmische Bewegung unter freiem Himmel wirkt ganzheitlich: Ein Spaziergang kurbelt das Immunsystem an und wirkt heilsam auf die Psyche. Ein Spaziergang regt an, ohne zu überfordern. Ein Spaziergang gibt mehr Energie, als er kostet. Spazieren ist ein Gang in die Welt und zugleich ein Gang nach Innen. Wie die Perlen einer Kette reiht sich Eindruck um Eindruck aneinander. Einsichten, Aussichten oder Begegnungen machen jeden Spaziergang einmalig. Man fühlt sich bereichert, wieder in Verbindung mit der Natur und mit sich selbst. Der Soziologe Hartmut Rosa nennt dies „Resonanz“.
„Ich wollte verstehen, warum sich das Wohlbefinden durch einen Spaziergang innerhalb kurzer Zeit deutlich verbessert“, begründet die Autorin ihr Buchprojekt. Sie geht seit Jahren regelmäßig mit seelisch belasteten Menschen spazieren. In Streifzügen durch Psychologie und Medizin, Literatur und Geschichte erkunden die Leserinnen und Leser den Zusammenhang zwischen Gehen, Denken und Fühlen. So lässt sich erfahren, warum wir beim Spazieren Stress und Anspannung reduzieren, uns rasch entspannen, kreativer werden, einfacher Probleme lösen können, achtsamer sind und Sinn erleben. Selbst im professionellen Bereich wird nun spaziert: Meetings in Kleinstgruppen finden draußen statt, ebenso Paar- und Gruppentherapie.
Ideen für 20 Spaziergänge – jeder einzelne ein Unikat
Die Autorin bietet in ihrem Buch 20 Spaziergänge mit unterschiedlichem Fokus. Der Mensch, sein Innenleben und die Außenwelt finden Schritt für Schritt zusammen. Die Autorin entschied sich bei der Auswahl der Spaziergänge für drei Bereiche, die Kopf und Körper guttun:
- Achtsame Spaziergänge, z.B. nachts, barfuß oder „ganz Ohr“
- Spaziergänge zum Umgang mit Gefühlen, z.B. problemlösend, beruhigend oder heilend
- Spaziergänge für die aktive Lebensgestaltung, z.B. für die Beziehung, für die Kreativität, für den Neubeginn
Sicherheit beim Spazieren in der Corona-Zeit
Darf ich überhaupt noch raus? Ja, man darf – und sollte sogar, sofern man die Regeln beachtet: Selbstverständlich gilt auch für einen Spaziergang, sowohl beim Laufen als auch beim Verweilen, den Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen einzuhalten. Am besten spaziert es sich derzeit allein oder mit maximal vier Personen aus demselben Haushalt. Generationen sollten sich nicht mischen, das bedeutet: Der Spaziergang mit den Großeltern und Enkelkindern wird verschoben. Zum Schutz anderer sind die Verhaltens- und Hygieneregeln des Bundesamtes für Gesundheit einzuhalten.
Die Umfrage beweist es: Spazieren hilft!
Warum, wann, wo und wie gehen wir spazieren? Die Ergebnisse der privat initiierten Spaziergangsumfrage mit Unterstützung der Universität Basel sind ebenfalls im Buch nachzulesen. Das wichtigste Fazit: Spazieren hilft jedem bei (fast) allem! Interessierte können weiterhin an der Umfrage teilnehmen.
Über die Autorin:
Sabine Claus lebt im Kanton Zürich und ist Master of Advanced Studies in Coaching & Organisationsberatung und Betriebswirtschaftlerin. Seit dem Jahr 2000 unterstützt sie Unternehmen, Teams und Einzelpersonen in Veränderungsprozessen und bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung. Daneben arbeitet sie in der Privatklinik Hohenegg für Psychiatrie und Psychotherapie als Team- und Projektleiterin sowie als Initianten des Angebotes „Naturnahe Achtsamkeit“. Ihr erstes Buch Mein allerbestes Jahr. Ziele erreichen – dem Leben Richtung geben ist 2015 im Junfermann Verlag erschienen.
Weiterführende Links:
Link zur Umfrage: https://sec.psycho.unibas.ch/kppt/index.php/238551?lang=de
Corona-Tagebuch, Teil 6: Was wir gerade aus der Krise lernen
Von Simone Scheinert
Es war ein komisches Gefühl, am Abend des 17. März den Verlag zu verlassen. Ich hatte schon einen Home-Office-Arbeitsplatz, da ich jeden Freitag von zuhause aus arbeite. Aber zu wissen, dass man auf unbestimmte Zeit nicht in den Verlag kommt, die Kolleg*innen so schnell nicht persönlich wiedersieht und dass gar nicht klar ist, wie das alles ausgeht – das war unheimlich und hatte nichts von dem erhebenden Gefühl, mit dem man sonst in den Urlaub geht, im Gegenteil. Ganz schnell hab ich als Botschaft, für alle, die weiter in den Verlag kommen, abends noch aufs Whiteboard geschrieben: Bitte gießt gelegentlich meine Blümchen! Und kam mir dabei vor, als ginge ich mindestens in Rente und nicht ins Home-Office.
Nach gut zwei Wochen Arbeit zuhause kann ich eine erste, vorsichtige Bilanz ziehen. Das Arbeiten von zuhause aus hat bislang besser funktioniert, als wir alle dachten. Denn, ganz ehrlich, so richtig vorbereitet waren wir nicht. Es gab insgesamt nur drei Heim-Arbeitsplätze mit Serverzugriff – einer davon ist meiner. Also habe ich mich zunächst mal hauptsächlich um die Bearbeitung unserer Webshop-Bestellungen gekümmert und Rechnungen geschrieben, was ich im Verlag nur als Urlaubsvertretung oder bei unserer Sparbuch-Aktion aushilfsweise getan habe.
Andere Dinge, die wir normalerweise im Team besprechen und entscheiden, konnten wir über eine Dropbox besser als erwartet lösen. Wir telefonieren, haben eine Verlags-Whatsapp-Gruppe, wir zoomen, wir skypen (und bekommen dabei interessante Einblicke in die Wohnungen der Kollegen 😊) … es läuft, und es läuft diszipliniert und gut.
Im meinem Hauptbereich Marketing ist derzeit alles anders. Ich weiß nicht, ob die Zeitschriften, in denen wir normalerweise Anzeigen schalten, am Ende des Jahres noch da sind. Ich weiß nicht, ob die Geschäftspartner, die Coaches, die Trainer, die Therapeuten mit denen wir zu tun haben, diese Krise gut überstehen. Ich hoffe es von Herzen.
Alle, nicht nur die Verlage, müssen jetzt stärker aufs Budget achten. Anzeigenbuchungen werden storniert, Veranstaltungen sind abgesagt, es wird keine Büchertische geben. Eingetretene Pfade sind plötzlich nicht mehr begehbar. Wir müssen kreative Wege finden und uns gegenseitig helfen und unterstützen. Das Denken ändert gerade die Richtung – wie gut, dass der Kopf rund ist!
Und dann ist da ja noch unsere Zeitschrift „Praxis Kommunikation“. Gerade entsteht Ausgabe 2, die Ende April erscheinen soll. Praxis Kommunikation bekommt gerade eine ganz neue Bedeutung – denn alle Absprachen, die ich mit meinem Kollegen aus der Grafik sonst direkt treffe, machen wir jetzt telefonisch. Die Layouts können wir diesmal nicht direkt gemeinsam am Monitor begutachten. Also müssen wir mailen, telefonieren, pdfs hin- und herschicken, pragmatische Lösungen finden und nochmal telefonieren. Uns immer wieder verständigen. Das Beste daran: Es funktioniert! Auch ohne Präsenz und mit Social Distancing. Es wird ein schönes Heft werden, und das freut mich gerade noch viel mehr als sonst.
Ich lerne etwas, trotz all dem Elend, das die Corona-Krise über die Welt bringt: Wir Menschen sind flexibel. Wir finden Lösungen und verlassen unsere gewohnten Muster, wenn es drauf ankommt. Wir sind, trotz aller Unterschiede, ein Team mit dem gleichen Ziel. Die kleine Perfektionistin in mir lernt gerade übrigens: Manchmal ist „gut genug“ auch wirklich gut, mehr braucht es nicht.
Jetzt kratzt unser Kater an der Terrassentür und will ins Haus – wenigstens das ist noch wie immer!
Corona-Tagebuch, Teil 5: Was macht eigentlich der Vertrieb in Zeiten von Corona?
Von Stefanie Linden
Man könnte meinen: Alles hat geschlossen, also kann der Vertrieb die Beine hochlegen. Weit gefehlt, denn als Bindeglied zwischen Verlag und Buchhandel, Zwischenhandel sowie Onlinehandel laufen bei mir die Fäden zusammen und wollen auch so manches Mal entwirrt werden. Es gibt viele telefonische Kontakte zu meinen Buchhändlern, die in dieser Situation manchmal nur den persönlichen Austausch suchen – ich nenne es inzwischen „virtuelles Kuscheln“. Manchmal müssen auch Probleme besprochen werden, die mir sehr nahe gehen, und wieder ein anderes Mal werden Bücher bestellt oder es wird eine Online-Aktion geplant, für die diverse Informationen und Coverabbildungen benötigt werden. Bisher konnten wir aber für jedes Problem eine Lösung finden, mit der sich alle Beteiligten wohlfühlen können.
Und dann wäre da auch die Vorschau mit den Herbstnovitäten 2020.
Nachdem wir alle im Verlag richtig „rangeklotzt“ haben, um die Vorschau „Herbst 2020“ auch unter Homeoffice-Bedingungen zu einem guten Ende zu bringen, fängt bei mir die Arbeit richtig an. Titel müssen in unserem Verlagssystem angelegt, an die Zwischenbuchhändler gemeldet und an die verschiedenen Systeme gemailt und dann bearbeitet werden.
Und die fertige Vorschau wird erstmals nicht in gedruckter Form vorliegen, sondern als PDF-Datei, die ich an meine Buchhändler per Mail verschicke. Dafür brauche ich aber einen aktuellen und vollständigen Mail-Verteiler, um den ich mich jetzt kümmern muss. In Buchhandlungen wechseln gelegentlich Ansprechpartner, weshalb Verteilerpflege eigentlich eine permanente Aufgabe ist, für die ich unter normalen Bedingen aber nicht immer die notwendige Zeit habe. Doch jetzt ist die Zeit dafür da – und ein aktueller Verteiler ist wichtiger denn je.
Doch es gibt nicht nur Wechsel und Veränderung. Viele Buchhändler und Buchhändlerinnen kenne ich schon 18 Jahre. Deshalb verschicke ich nicht einfach eine Datei (die Vorschau-PDF), sondern füge auch ein Anschreiben bei, denn mir ist die persönliche Ansprache sehr wichtig. Es sind in den Jahren Freundschaften entstanden und die Sorgen, die wir im Verlag und meine Buchhändler im Handel haben, sind geteilt vielleicht nur noch halb so schwer.
Nach dem Versand werde ich dann mit meinen Buchhändlern telefonieren, um Telefontermine für die Vorschaubesprechung zu vereinbaren. Ich hatte bereits mit großem Vorlauf einige Besuchstermine vereinbart. Die müssen nun leider in Telefontermine umgewandelt werden. Außerdem müssen Flüge und Hotels storniert oder umgebucht werden. Eine Buchhandelsreise in diesem Jahr wird wohl nicht möglich sein. So freue ich mich aber umso mehr auf 2021.
Und zu guter Letzt: Es liegen noch ganz viele administrative Dinge auf meinem Homeoffice-Tisch (der eigentlich unser Esstisch ist), die so überhaupt nicht spannend sind. Aber auch sie wollen erledigt sein und erfordern häufig viel Konzentration – und Zeit. Aber Zeit ist ja genau das, was wir gerade am meisten haben.
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Corona-Tagebuch, Teil 4: Positive Entwicklungen
Wir haben in unseren letzten Beiträgen ja viel über das geschrieben, was uns nachdenklich stimmt und Sorgen bereitet. Es waren ernste Beiträge. Gibt es denn gar nichts Leichtes und Freundliches, das uns fröhlich stimmen könnte?
Wenn ich gut drauf sein möchte, telefoniere ich am besten mit einem unserer Druckdienstleister. Für uns ist er schon viele Jahre tätig, hat kleinste und auch sehr große Aufträge abgewickelt. In den letzten Jahren ist er selbst in schweres Fahrwasser gekommen und hat sich beharrlich und erfolgreich wieder rausgearbeitet. Das hat wohl auf sein Resilienz-Konto eingezahlt, und wenn ich heute mit ihm spreche, sprüht er nur so vor Optimismus, dass „das“ schon alles wieder gut werden wird.
Dieser Drucker nun hat gerade ein Produkt „in der Mache“, dessen Fertigstellung – wären wir jetzt alle hier – uns zu wahren Begeisterungsstürmen hinreißen müsste. Spontan hätte vielleicht jemand eine Flasche Sekt aufgemacht; mindestens eine.
Heute nun stand der Drucker mit strahlendem Gesicht in der Tür und hatte die ersten Muster für mich dabei. Das war wirklich ein erfreulicher Moment, den ich gleich mit dem Autor teilen musste. Es hätte nicht viel gefehlt, und er wäre quer durchs Land direkt zu uns gefahren, um seine Belege selbst abzuholen …
Um was für ein Produkt handelt es sich aber nun? Das ist das Rätsel, das ich heute aufgeben möchte. Und dazu ein paar Hinweise:
- Die Fertigstellung hat sehr lange gedauert, länger als drei Jahre – von der Idee bis heute.
- Der Autor ist schon seit längerer Zeit erfolgreich in bestimmten Bereichen des Themas unterwegs. Er hat es sich (nicht nur) für das Produkt sehr umfassend erarbeitet und Berge von Fachliteratur und aktueller Forschung durchgeackert.
- Dieses Produkt ist natürlich größere geworden als ursprünglich geplant.
- Es ist der einzige Titel, den wir – aufgrund der langen Verzögerungen – in zwei Vorschauen angekündigt haben: 2018 und 2020.
So, hat jemand eine Idee, wovon ich hier rede?
Corona-Tagebuch, Teil 3: Social Distancing
Social Distancing, die Wahrung sozialen Abstands – das ist der Begriff für die Verhaltensmaßregel der Stunde. Und so sinnvoll, ja geradezu lebenswichtig die Sache an sich ist, so unglücklich erscheint die Wortwahl. Denn wenn diese Tage in Home-Offices und auf dem heimischen Sofa, mit drohendem Lagerkoller und zunehmend katastrophalen Nachrichten uns eines lehren, dann doch dies: dass nächst unserer Gesundheit eben nicht Klopapier das Wichtigste für unser Wohlergehen ist, sondern soziale Nähe und Austausch. Und so gilt es, trotz und parallel zur Wahrung körperlichen Abstands eine Social Closeness zu praktizieren, deren Wert wir gerade jetzt völlig neu einzuschätzen lernen. Beides schließt sich nicht aus – gegen das Gespräch mit dem Nachbarn, der Nachbarin aus sicherer physischer Distanz spricht ebenso wenig wie gegen den Einsatz aller technischen Errungenschaften, die uns in den letzten Jahren das Kommunizieren vereinfacht haben: all die Messenger-Dienste, Videotelefonie-Apps, Gruppenchats und Sprachmemos stehen uns zur Verfügung, ebenso das gute alte Telefon. Wir müssen sie nur nutzen, was zuweilen ein wenig Überwindung fordert, aber lohnenswert ist. Wenn Sie ein paar virtuelle Schritte auf lang vernachlässigte Freunde, Verwandte oder Bekannte zugehen, werden Sie feststellen, wie gut das tun kann. Bleiben Sie in Kontakt.
Für die Momente, in denen wir dann doch wieder auf uns selbst zurückgeworfen sind, sollte man meinen, dass jene Kulturtechnik, die uns am effektivsten beibringt, wie man gut allein sein kann, eine Renaissance erleben würde: das Lesen. Doch dem ist allem Anschein nach nicht so. Zwar titelte DIE ZEIT letzte Woche noch hoffnungsfroh „Das Lesen geht weiter“, doch diese Hoffnung hielt nur ein paar Tage (wie so vieles im Moment). Nun bleiben die Buchhandlungen geschlossen, die Büchereien ebenfalls und die Onlinehändler verschicken nurmehr eines – Klopapier! Aber das ist kein Grund zum Verzicht auf neuen Lesestoff. Auch hier gilt: Es kostet ein wenig Überwindung, lohnt aber den Versuch! Die Lieferketten sind zwar eingeschränkt, aber noch ist unsere Branche nicht zusammengebrochen. Gerade weil der große Online-Versender im Moment mit Sanitärartikeln glänzen zu können meint, gibt es für uns vielleicht neue Erfahrungen zu machen. Wie etwa, dass unsere Buchhandlung vor Ort eine eigene Website mit einem Shop hat; dass wir die Kolleg*innen dort sogar telefonisch oder per E-Mail erreichen können, obwohl das Ladengeschäft geschlossen bleiben muss. Und aus ganz vielen Städten hören wir, dass bestellte Bücher nicht nur nach Hause versandt werden, sondern von engagierten Buchändler*innen per Fahrrad in die Briefkästen der Kunden gebracht werden. Probieren Sie’s aus und lassen Sie sich etwas zu lesen bringen. Vielleicht entsteht auf diesem Wege ja sogar eine soziale Nähe zu Ihrer Buchhandlung vor Ort, die den Corona-Ausnahmezustand überdauert.
Corona-Tagebuch, Teil 2: Trübe Aussichten?
Der Blick aus dem Fenster bietet heute einen bedeckten Himmel, kein Sonnenstrahl weit und breit. Immerhin fällt es uns dann leichter, nicht rauszugehen, höre ich im Radio auf dem Weg zur Arbeit. Noch dürfen wir rausgehen, auch wenn wir es nicht mehr sollen. Und es ist schon so viel gekommen, das vor wenigen Tagen völlig unvorstellbar schien. Deshalb kann man wohl davon ausgehen, dass eine Ausganssperre nicht mehr lange auf sich warten lässt. Schöne Aussichten, nicht wahr?
Legt man eine weite Strecke mit dem Flugzeug zurück, dann heißt es ja: Der Körper ist angekommen, die Seele braucht ein paar Tage. Das gilt wohl nicht nur für Reisen. Wenn sich unser Leben binnen kürzester Zeit so grundlegend ändert, dann haben wir die Tatsachen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist da aber unsere Seele, die die Maßnahmen von vor drei Tagen noch gar nicht verarbeitet hat und jetzt ständig mit neuen Gegebenheiten konfrontiert wird. Sie kommt einfach nicht nach. Wir kommen einfach nicht nach.
Das wurde mir gestern im Gespräch mit einer befreundeten Buchhändlerin sehr deutlich. Ich rief sie an, um zu fragen, ob der Laden denn jetzt dicht sei. Die Buchhandlung muss bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Sie bietet ihren Kundinnen und Kunden jetzt an, dass sie online Bücher bei ihr bestellen können und sie liefert sie ihnen mit dem Fahrrad nach Hause. Aber was wird aus diesem Plan B, wenn sie sich nicht mehr draußen bewegen darf? Sie wird Kurzarbeit für ihre Mitarbeiterinnen beantragen und ist entschlossen, eine Weile durchzuhalten. Aber wie lange dauert diese Weile?
Immerhin: Ein großer Online-Händler hat verkündet, dass ihm der Versand von Gebrauchsgütern momentan wichtiger ist als der Versand von Büchern. Wenn dort gilt: Toilettenpapier statt Bücher – dann haben vielleicht die stationären Buchhandlungen hier kurzfristig eine ganz gute Lücke …
Doch es gibt auch Erfreuliches zu berichten: Die Autobahnen sind so leer wie lange schon nicht mehr, der Weg zur Arbeit ist deutlich entspannter. Wir bekommen haufenweise aufmunternde und unterstützende Mails – und die tun wirklich gut. Unsere Autorin Fabienne Berg zum Beispiel hat angekündigt, dass sie uns besuchen will, wenn „das alles hier“ vorbei ist. Und dann bringt sie Kuchen mit. Das sind doch wirklich erfreuliche Aussichten!















