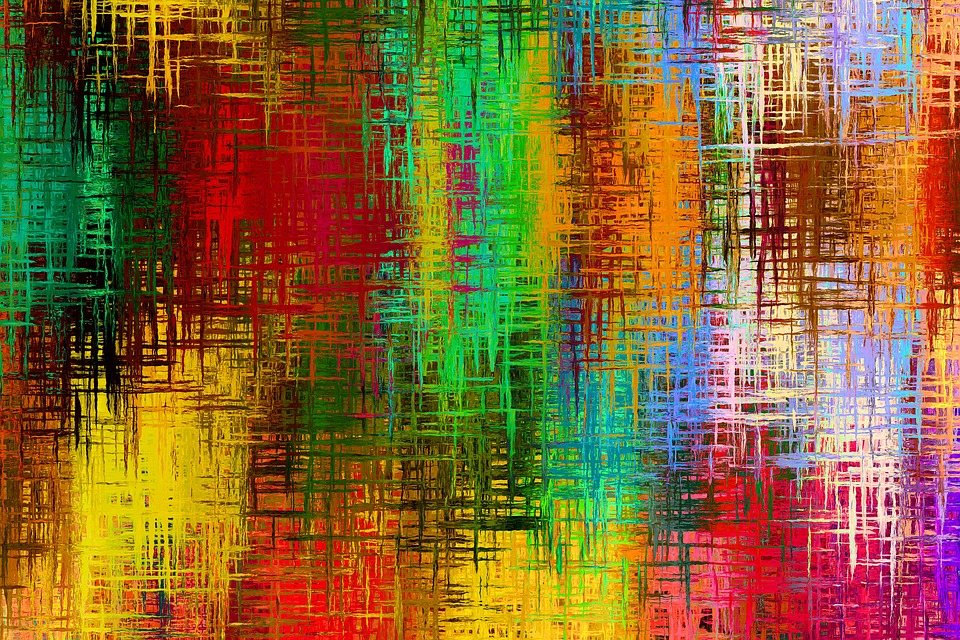Stand statt Strand: die Frankfurter Buchmesse 2016
Wer kennt das nicht? Man tippt auf seinem Handy rum – und zack! – bringt sich die Autokorrektur kreativ ein. Das passierte mir auf der gerade beendeten Frankfurter Buchmesse. Das Wort „Stand“ will ich schreiben – und was wird daraus? „Strand“!
„Wäre ja schön“, denke ich mir – und korrigiere. Zwar ist um mich herum auch Rauschen zu hören, aber nicht von und Wellen hervorgerufen, sondern von Tausenden von Menschen, die sich durch die Gänge schieben. Und es flüstert auch nicht der Sommerwind, sondern es reden – mal lauter, mal leiser – an allen Ständen Aussteller und ihre jeweiligen Gäste. Man kann froh sein, wenn nicht irgendein elektronisches Gedudel hinzukommt, das dann leider kein Möwenkreischen ist.

Gäste am ersten Messetag: Junfermann-Autorin Martina Schmidt-Tanger (rechts) und Claudia Maurer (links)
Was aber bringt all diese Menschen dazu, Jahr für Jahr Zeit in lauten Messehallen mit schlechter Luft zu verbringen? Unser Besuch am Messemittwoch, Martina Schmidt-Tanger, fragt mich genau das. Wer sind all diese Messebesucher? Was treibt sie hierher? Ich versuche es mit einer teils historischen Begründung, dass nach der Erfindung des Buchdrucks überregionale Marktplätze nötig waren, um die eigene Produktion zeigen und unters Volk bringen zu können. So sind Buchmessen einst entstanden.
Und braucht man sie jetzt noch? Hat man nicht andere und bessere Möglichkeiten? Sicher. Aber nichts ist Beziehungen zuträglicher, als ab und an persönlich miteinander zu sprechen, von Angesicht zu Angesicht. Und wo treffen sich Jahr für Jahr Verlegerinnen, Autoren, Dienstleisterinnen aller Art, Lektoren, Einkäuferinnen und Agenten? Auf der Buchmesse natürlich. Also doch nicht an den Strand, sondern an den Stand, in Frankfurt.
Doch am dritten Messetag gibt es für mich dennoch einen Hauch von Strand. Die Gastländer 2017 – die Niederlande und die belgische Region Flandern – haben für ein wenig Meeresambiente gesorgt. Hinter Gazevorhängen glaubt man das Meer zu sehen. Begibt man sich hinter diese Kulisse, finden sich dort – Bücher! Was sonst? Schließlich sind wir auf der Frankfurter Buchmesse.
Übrigens: Unter #JuBuMe16 finden Sie auf Twitter einige weitere Messeeindrücke.
Wer konnte punkten? – Das erste Clinton-Trump-TV-Duell mimisch betrachtet
In der Nacht vom 26. auf den 27. September fand das erste TV-Duell zur amerikanischen Präsidentschaftswahl statt. Wer würde besser abschneiden? Würde Donald Trump verbal und emotional entgleisen? Würde Hillary Clinton ihr Image, arrogant und unterkühlt zu sein, verändern können? Und: Wie fit würde sie nach ihrem Zusammenbruch infolge einer Lungenentzündung sein?
Auch in Deutschland wurde das TV-Duell von großem Interesse begleitet. In den Nachrichten am 27. September lautete das Urteil: Punktsieg und leichte Vorteile für Clinton, aber kein K.o.-Schlag für Trump.
Ein Junfermann-Autor absolvierte am 27. September einen wahren Pressemarathon. Die Rede ist von Dirk Eilert, Experte für Mimik, Körpersprache und Emotionen. Von seinem Buch Mimikresonanz. Gefühle sehen. Menschen verstehen wurden seit dem Erscheinen vor drei Jahren mehr als 10.000 Exemplare verkauft.
Dirk Eilert war medial auf allen Kanälen unterwegs: Morgens im Fernsehen und zwar im Sat1-Frühstücksfernsehen. Dort wurde er von Moderator Daniel Boschmann befragt. Abends dann konnte man ihn in der von Alexander Kähler moderierten Phoenix-Runde sehen, zusammen mit dem Journalisten Matthew Karnitschnig (Politico), dem Kommunikationsberater Axel Wallrabenstein und Sudha David-Wilp (German Marshall Fund).
„Trump stand nur einmal wirklich unter Stress“, lautete seine Bilanz in einem Interview mit der Zeitung Die Welt. Bleibt noch, ein Radiointerview mit DRadio Wissen in diese Aufzählung aufzunehmen.
Und zu welchen Ergebnissen ist Dirk Eilert nun gekommen? Zunächst einmal haben beide, sowohl Clinton als auch Trump, das umsetzen können, was sie sich vorgenommen hatten. Er ist staatsmännischer rübergekommen, sie nicht ganz so unterkühlt. Bei diesem Zusammentreffen eines Extrovertierten mit einer Introvertierten lässt sich wohl bei Clinton eine größere  Entwicklung feststellen. Dirk Eilert beobachtet Hillary Clinton bereits sehr lange, in ihrer Zeit als First Lady und danach als Senatorin und dann als Außenministerin. In ihrer Körpersprache ist sie expressiver geworden. „Trump ist Trump“, meint Dirk Eilert. Er ist kongruent in dem was er sagt und wie er es ausdrückt. Clinton hat, im Gegensatz zu Trump, immer mal wieder Stresssignale gezeigt. Dabei hatte ihr Kontrahent in diesem TV-Duell diverse schwierige Themen (vorerst) ausgespart. Allerdings zeigte er auch ein Dominanzgebaren, das ihm nicht unbedingt Sympathiepunkte einbringen dürfte. So blieb er bei der Begrüßung kurz stehen, zwang Clinton dadurch, auf ihn zuzugehen. Dann legte er ihr die Hand auf den Rücken, eine Geste, die dem Ranghöheren bei einem Rangniedrigeren „zustehen“ würde. Bei der Verabschiedung wiederholte er das, sogar noch in verschärfter Form. Wie ein „guter Onkel“ klopfte er ihr gönnerhaft auf den Rücken.
Entwicklung feststellen. Dirk Eilert beobachtet Hillary Clinton bereits sehr lange, in ihrer Zeit als First Lady und danach als Senatorin und dann als Außenministerin. In ihrer Körpersprache ist sie expressiver geworden. „Trump ist Trump“, meint Dirk Eilert. Er ist kongruent in dem was er sagt und wie er es ausdrückt. Clinton hat, im Gegensatz zu Trump, immer mal wieder Stresssignale gezeigt. Dabei hatte ihr Kontrahent in diesem TV-Duell diverse schwierige Themen (vorerst) ausgespart. Allerdings zeigte er auch ein Dominanzgebaren, das ihm nicht unbedingt Sympathiepunkte einbringen dürfte. So blieb er bei der Begrüßung kurz stehen, zwang Clinton dadurch, auf ihn zuzugehen. Dann legte er ihr die Hand auf den Rücken, eine Geste, die dem Ranghöheren bei einem Rangniedrigeren „zustehen“ würde. Bei der Verabschiedung wiederholte er das, sogar noch in verschärfter Form. Wie ein „guter Onkel“ klopfte er ihr gönnerhaft auf den Rücken.
Das sind nur einige Schlaglichter. Die ausführlichen Analysen von Dirk Eilert können Sie nachlesen, nachhören bzw. in Videoclips anschauen – und zwar hier:
Ab in die Kiste! Wir ziehen um
Größer, schöner und mehr Möglichkeiten: Damit lassen sich unsere neuen Räumlichkeiten an der Driburger Straße charakterisieren, in die wir am 28.9.2016 umziehen werden. Doch bevor wir die Qualitäten unseres neuen Domizils auskosten können, muss erstmal der ganze Verlag in Kisten verpackt werden.
„Ist doch eigentlich gar nicht so schlimm“, dachten wir uns. Schließlich waren wir erst zum Jahreswechsel 2010 / 2011 von der Imadstraße an die Andreasstraße gezogen. Damals hatten wir bergeweise Zeug zu entsorgen. Es hatte Lagerräume gegeben und meterweise Wandschränke, in die wir sorglos alles gepackt hatten, was nicht direkt gebraucht wurde. Und all das mussten
wir vor dem Umzug loswerden.
Doch kann sich wirklich in fünf Jahren auf relativ engem Raum so viel ansammeln? Die Antwort lautet: Ja!
Aber nun sitzen wir quasi auf gepackten Kisten und freuen uns auf das Neue. Heute konnten wir erneut einen Blick in die fast fertigen Räume werfen, in denen Handwerker fleißig Strippen ziehen, die uns hoffentlich beim Einzug nicht zum Stolperseil werden.
Ach ja: Wir haben vom Umzugsunternehmen Aufkleber bekommen, mit denen alles beklebt werden muss. Wirklich. Alles!
Unsere neue Anschrift lautet übrigens: Driburger Str. 24d, 33100 Paderborn
20 Jahre DVNLP: Würdigung der Vergangenheit und Gestaltung der Zukunft
Das NLP der Zukunft ist „die Sprache der Veränderung“
Ein spannendes Ereignis wirft seine Schatten voraus: Das größte unabhängige NLP-Experten-Forum – der Deutsche Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren (DVNLP) – feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen.
1996 verfolgte eine kleine Gruppe von Menschen die Vision, eine starke Gemeinschaft von NLP-Anwenderinnen und -Anwendern zu schaffen. Dafür schlossen sich die Vorstände der „German Association for Neuro-Linguistic Programming“ (GANLP) und der „Deutschen Gesellschaft für Neuro-Linguistisches Programmieren“ (DGNLP) sowie die „Resonanzgruppe“ von Gundl Kutschera zu einem gemeinsamen NLP-Verband zusammen. Im Vordergrund stehen bis heute Qualitätssicherung und Bündelung von Kompetenzen.
In den 20 Jahren seines Bestehens hat der Verband einige Krisen gemeistert, um den Geist des NLP nicht aus den Augen zu verlieren. Ausbildungsrichtlinien und Berufskodex sollen für ein solides Gerüst, eine fundierte Basis sorgen, Regional- und Fachgruppen für die Verbreitung und Weiterentwicklung. Robert Dilts wurde 2002 als Ehrenmitglied in den Verband aufgenommen – und immer wieder wird die Frage nach dem Selbstverständnis, der gemeinsamen Vision diskutiert.
Der diesjährige NLP-Kongress, der vom 29. bis zum 30. Oktober in Berlin stattfindet, beschäftigt sich mit ebendiesem Thema: 28 Workshops, Seminare und Vorträge zum Thema Zukunft des NLP werden angeboten und bieten das Parkett für weiteren Austausch.
Erstmals werden auch Workshops und andere Veranstaltungen zu Bereichen wie Marketing, Werbung, Steuern und Recht oder BWL angeboten, die sich gezielt an Trainer und Coaches als Unternehmer richten.
Wie es zu dieser Neuerung kam, erklärt Sebastian Mauritz, Vorstand Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DVNLP: „Als DVNLP stehen wir neben Qualität auch für Service für unsere Mitglieder. Dies soll sich auch auf unserem Kongress widerspiegeln. Die Idee stammt von unserem Vorstandsmitglied Thomas Pech und wurde vom Vorstand sehr gut aufgenommen. Die Umsetzung erfolgte mit Profis aus unterschiedlichsten Bereichen, die unsere Mitglieder als Unternehmerinnen und Unternehmer ansprechen und weiterqualifizieren.“
Ebenfalls neu bei diesem Kongress: Durch eine Kooperation mit dem systemischen Verband Infosyon wird eine Brücke geschlagen zwischen NLP und dem systemischen Ansatz in Aufstellungen.
NLP und Systemik – Ist eine stärkere Zusammenführung beider Felder eines der Ziele für die Zukunft? Sebastian Mauritz dazu: „Die Verbindung liegt nahe und ist aus meiner Sicht eine logische Weiterentwicklung der Arbeit an den Wurzeln des NLP. Es geht um die weitere Professionalisierung und noch stärkere Marktfähigkeit. Da ist die Betonung der systemischen Aspekte zusammen mit unserem Wunsch-Kooperationspartner Infosyon naheliegend.“
Und noch eine bewusste interdisziplinäre Ausweitung wird es im Oktober geben: Prof. Dr. Gerhard Roth eröffnet am Samstagmorgen den Kongress mit seiner Keynote zum Thema „Die Wirkung von Coaching aus Sicht der Hirnforschung“. Soll es zukünftig mehr Bestrebungen geben, die Wirkweise von NLP wissenschaftlich zu untermauern, um dem Vorwurf, eine Pseudowissenschaft zu sein, zu entkräften? „Der Vorwurf der Pseudowissenschaft ist aus meiner Sicht ein alter Hut“, sagt Sebastian Mauritz, „Scheinbar braucht es aber immer wieder die Herabsetzung von NLP, um die eigenen Methoden aufzuwerten. Das dort oftmals Äpfel mit Birnen verglichen werden und dass die eigenen ‚wissenschaftlichen‘ Methoden genauso wissenschaftlich oder unwissenschaftlich wie NLP sind, wird meist verschwiegen. Gerade die Wirkforschung zeigt sehr deutlich, dass die Methode viel weniger Wirkung hat, als die Verbindung zwischen Klient und Berater und das Vertrauen des Beraters in seine Methode. Um noch mal auf die Frage einzugehen – und ja, wir versuchen in diesem Bereich mehr Klarheit zu gewinnen –, wird es im ersten Schritt eine Art Forschungslandkarte geben, die den Begriff der Wissenschaftlichkeit erstmal erläutert.“
In jedem Fall können spannende Impulse für die Zukunft des NLP erwartet werden. Ralf Stumpf beispielsweise erläutert in seinem Vortrag „Das NLP der Zukunft ist ‚die Sprache der Veränderung‘“, dass NLP gerade erst am Anfang stehe: „Wir kennen einige der Vokabeln, aber wir kennen noch nicht alle“, heißt es in seinem Ankündigungstext.
Und Stephan Landsiedel prophezeit: „Das NLP der Zukunft wird auf den Nutzer individuell zugeschnitten sein und Kontextvariablen viel stärker berücksichtigen als die bisherigen Standard-Interventionen der Psychologie.“
Neben diesen Zukunftsfragen sollen auch aktuelle Themen bzw. Trendthemen aufgegriffen werden. „NLP und Flüchtlinge“ lautet ein Vortrag von Diplom-Psychologen Sascha Neumann. Und Manuela Mätzener greift Hochsensitivität als „Zeitphänomen“ auf.
Im Workshop von Michael Heß und Dr. Dagmar Müller wird das Modell der Logischen Ebenen nach Robert Dilts „anhand eines neuartigen Tools sichtbar, greifbar und erlebbar gemacht“.
Könnte man also den diesjährigen Kongress als die Gleichung NLP-Spirit aus der Vergangenheit + Phänomene und Erfordernisse der Gegenwart = integriertes NLP in der Zukunft verstehen? Sebastian Mauritz, der seit 2012 zum NLP-Vorstand gehört, meint:
„Ich würde das nicht unbedingt gleichsetzen oder eine linear-kausale Folgerung ableiten. Es sind die Wechselwirkungsprozesse, die zwischen Phänomenen, die sich in der Welt zeigen, und den Beobachtern dieser Phänomene, die relevant sind. Es geht also um Erklärungs- und Handlungs- und Umgangsmodelle. Hier erhöht NLP seit Jahrzehnten die Selbststeuerungsfähigkeit und Resilienz seiner Anwender. Im sozialen und kulturellen Miteinander fördert es zugleich Verständnis und Verständigung – von beidem kann es meines Erachtens gerade fast nicht genug geben.“
Auf der Website des DVNLP wird die Vision des heutigen NLP so beschrieben: „Wir wollen Sie als Mitglied noch besser darin unterstützen, Ihre eigenen Visionen zu verwirklichen und Ihre Fähigkeiten bestmöglich einzusetzen.“
Sind es eher die gesamtgesellschaftlichen Belange, für die NLP zukünftig eingesetzt werden und für die NLP Lösungen finden soll, oder besteht das Ziel eher in einer Individualisierung, einem Anpassen an die persönlichen Umstände? „Ich würde aus dem Entweder-oder ein Sowohl-als-auch machen“, erklärt Mauritz, „Für sich selbst eingesetzt ist NLP genauso nützlich wie dann in der Anwendung im gesellschaftlichen Bereich.“
Ohne Zweifel kann NLP in vielen Bereichen angewandt werden, und dennoch ist es noch lange nicht so etabliert, wie seine Anwenderinnen und Anwender es sich wünschen würden. Bleibt die Frage, wohin die Reise geht. Am letzten Wochenende im Oktober werden in Berlin vielleicht erste Antworten gefunden.
Und last but not least ein Hinweis in eigener Sache: Im Rahmen der Abend-Gala des NLP-Kongresses wird auch der Junfermann Verlag für seine Verdienste um das NLP geehrt. Unser Verlagsleiter, Dr. Stephan Dietrich, und Mitarbeiter des Verlags sind daher zugegen und feiern mit. Vielleicht sieht man sich ja! 😉
Das komplette Programm sowie weitere Informationen finden Sie hier.
Strand oder Buch? – Das ist hier die Frage …
Mark Twain wusste schon: „Schreiben ist leicht. Man muss nur die falschen Wörter weglassen.“ Klingt simpel. Schade nur, dass Autor und Lektor bei der Bestimmung falscher Wörter nicht immer einer Meinung sind. Und auch in anderen Punkten können Autoren- und Verlagssicht stark voneinander abweichen. Was dann zu tun ist? Erst einmal den kleinsten gemeinsamen Nenner finden: miteinander reden, zuhören, transparent sein.
Es folgt: ein (kritischer) Blick auf das „Büchermachen“ – aus Perspektive zweier Autorinnen und eines Verlagsleiters
Wenig romantisch …
 Von Ruth Urban und Tanja Klein
Von Ruth Urban und Tanja Klein
Wer an das Schreiben von Büchern denkt und an die damit verbundenen Schwierigkeiten, der denkt oft an Schreibblockaden und zu viel Alkohol. Sieht den Autoren vor seiner Tastatur sitzen, auf den blinkenden Cursor starren, und ein Abdruck des Rotweinglases zeichnet sich auf dem Stapel Papier neben dem Rechner ab.
Weit gefehlt! Die Produktion unserer Fachbücher, das Schreiben, kennt kaum leere Blätter. Denn die erste Aufgabe ist es zu konzipieren, eine klare Struktur zu schaffen, und dann füllen sich die Seite schon.
 Struktur schaffen ist das erste Gebot
Struktur schaffen ist das erste Gebot
Trotzdem gibt es Momente stiller – und lauter – Verzweiflung. Warum tut man sich das an? Bei Tanja und mir sind diese Momente dieses Mal erst nach der Schreiberei aufgetaucht, und wir wollen ehrlich berichten, was einen – ganz und gar unromantisch – so umtreiben kann:
Wir wissen, dass auch andere Autoren bei anderen Verlagen mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben – aber wir wissen es wohl zu schätzen, dass wir so offen und klar kommunizieren können, was oft nur hinter verschlossenen Türen – wenn überhaupt – besprochen wird.
- Coverdesign: Solange man kein A-Promi ist, hat der Verlag das letzte Wort. Und ja, Tanja und ich sind diesmal auch unterschiedlicher Meinung.
Tanja: Ich war wirklich traurig, dass Ruth meinen Vorschlag mit den eckigen Äpfeln doof fand, und sie hätte eigentlich gerne lieber das Cover mit dem Holzherz gehabt …)
Ruth: Wir denken unisono aber immer wieder, dass die Cover-Gestaltung einfach mehr können muss. Für alle, die mehr wissen wollen – das hier ist ganz große Klasse und sehr, sehr lustig: https://www.ted.com/talks/chip_kidd_designing_books_is_no_laughing_matter_ok_it_is
- Titel und Untertitel: Viel zu sagen, wenig Worte zu Verfügung. Die Zielgruppe muss rein, dazu gehören auch Trainer. Was sind die richtigen Worte? Wir ringen zäh – mit uns und dem Verlag – und hätten so gerne unsere Vorwortschreiberin direkt auf dem Covertext selbst vorgestellt! (Tanja: Sorry, liebe Ann-Marlene, jetzt bist du ein Sticker auf dem Cover geworden!)
- Aussehen & Preis: Ein kommunikatives Missverständnis sorgte dafür, dass wir uns brüskiert vorkamen. Wir dachten, „wir“ erscheinen vierfarbig und als Hardcover gebunden. Es bleibt aber bei broschiert und farbig (Letzteres hat sich übrigens total gelohnt!). Auch beim Preis gibt es so viele Köpfe wie Meinung und zwei Lager, die sehr weit auseinanderliegen. Die Diskussion ist heiß. Am Ende überlassen wir dem Verlag die Entscheidung und geben nur einen groben Rahmen vor.
Wir danken Junfermann dafür, dass wir das so veröffentlichen dürfen, und wünschen uns, dass der Verlag mal schreibt wie es ihnen so mit uns und anderen stressigen Autoren 🙂 ergeht.
Und gegen Ende wird es dann doch wieder ziemlich romantisch: Das Auspacken der ersten Exemplare ist immer etwas ganz, ganz Besonderes! Und wir hoffen, dass unseren Lesern ganz ähnlich zu Mute sein wird – wenn sie das gelesene Buch zuschlagen.
 Herzklopfen in Folie verpackt: Das erste Exemplar!
Herzklopfen in Folie verpackt: Das erste Exemplar!
Dem Wunsch von Ruth Urban und Tanja Klein, die „Gegendarstellung“ des Verlags zu hören, kam unser Verlagsleiter Dr. Stephan Dietrich dann auch gerne nach:
Wer Romantik sucht …
… der möge, frei nach Helmut Schmidt, an einen einsamen Strand gehen, aber um Gottes Willen kein Buch schreiben und mit einem Verlag zusammenarbeiten. Da geht es, zumindest aus Perspektive des Verlags, so wenig um Romantisches, dass es für Autoren schnell frustrierend werden und, wie Ruth Urban und Tanja Klein es beschreiben, auch Momente der Verzweiflung erzeugen kann, wenn die eigenen Vorstellungen vom mühsam (oder auch beschwingt) entstandenen Werk auf jene des Verlags treffen.
Doch gehen wir zunächst einen Schritt zurück. Viel Reibung zwischen Autoren und Verlagen entsteht an der Grenze zwischen Generalisierung (die gemeinhin der Wiedererkennbarkeit und Profilschärfung des Verlags dient) und Individualität (die dem Spezifischen eines jeden Buchprojekts Rechnung tragen muss). Entscheidende Reibungsflächen aber sind ja bereits längst überwunden, bevor es überhaupt zu Fragen der Cover-, Titel-, Preis- und Ausstattungsgestaltung kommt: die des Inhalts. Denn eine der frühesten Fragen die wir im Verlag an neue Projekte stellen, betrifft nicht nur die inhaltliche Konsistenz, Originalität oder Brillanz des Projekts, sondern sein Verhältnis zum Profil des Verlags. Und es kommt nicht selten vor, dass wir vorzügliche Buchprojekte nicht realisieren können, weil sie (individuell) zwar ausgezeichnet sind, aber zum (generellen) programmlichen Umfeld des Verlags so wenig passen, dass wir sie nicht angemessen an die Interessenten vermarkten und vertreiben können. Diese Art der Verzweiflung nun blieb Ruth Urban und Tanja Klein ebenso erspart wie das gravierendste und am schwierigsten zu lösende Problem, das zwischen Autoren und Verlagen entstehen kann: Was tun, wenn sich im Verlauf der Arbeit oder gar erst am fertig eingereichten Manuskript herausstellt, dass die Vorstellungen von Inhalt und Didaktik sich auf beiden Seiten fundamental unterscheiden?
Was die Gestaltung und den Buchtitel betrifft, so sind Diskussionen darüber für uns im Verlag an der Tagesordnung. Wir führen sie gern und intensiv, nicht nur mit den Autoren, sondern auch unter uns. Dabei bietet die gegenwärtige, stark vereinheitlichte Gestaltung des Cover-Rahmens bei Junfermann nur sehr begrenzten Spielraum, der sich im Wesentlichen auf die Auswahl eines in Farbgebung und Format passenden sowie als möglichst starker „Hingucker“ funktionierenden Coverbildes beschränkt – auch wenn die Suche manchmal etwas länger dauert, erzielt man in diesem Punkt meist vergleichsweise rasch Einigkeit. Beim Thema Titelfindung haben die Autoren zunächst einmal den großen Vorteil, die Bücher weitaus besser zu kennen als alle anderen. Häufig aber geht damit als Nachteil das Bemühen einher, so viele inhaltliche Details wie möglich in dem begrenzten Raum handhabbarer Ober- und Untertitel unterzubringen, während dem Verlag wichtig ist, dass der Titel das Buch für jene Interessenten, die nach den entsprechenden Inhalten suchen, auffindbar macht und dass er ihnen einen Impuls gibt, sich das Buch zumindest näher anzuschauen (was im Übrigen für die bei Junfermann entstehenden Fachbücher und Ratgeber gilt, bei belletristischen Werken aber natürlich ganz anderen Kriterien folgt).
Viel interessanter, weil so außergewöhnlich, war jedoch im Falle von Tanja Kleins und Ruth Urbans neuem Buch die Frage des Verkaufspreises. Die übliche Argumentationslinie verläuft in diesem Punkt in etwa so:
Autor/Autorin: „Das Buch ist mit dem geplanten Preis viel zu teuer. Das können/wollen die Kunden sich nicht leisten. Macht es bitte billiger, damit mehr Leute es kaufen können.“
Verlag: „Bücher sind generell zu billig, der geplante Preis ist im entsprechenden Marktumfeld absolut konkurrenzfähig und signalisiert nicht zuletzt auch die Wertigkeit der Inhalte.“
In diesem Fall waren die Rollen aber gerade vertauscht: Die Autorinnen hatten den Wunsch, das Buch so hochpreisig wie möglich anzubieten und wir haben von Verlagsseite entschieden in Richtung eines Verkaufspreises argumentiert, der sich im Gefüge der generellen Preispolitik des Verlags und des Wettbewerbs noch rechtfertigen lässt. Das Ergebnis nach zahlreichen Diskussionen über einen langen Zeitraum hinweg kann nicht unbedingt als ein Kompromiss bezeichnet werden – umso dankbarer waren und sind wir Ruth Urban und Tanja Klein, dass sie bereit waren, in diesem Punkt die Perspektive des Verlags nachzuvollziehen und ihre eigenen Bedürfnisse zurückzustellen … 😉
Diagnose Autismus
Wie gehen die Eltern betroffener Kinder damit um?
Von Dr. Prithvi Perepa
Jede Familie ist anders. Daher fallen auch die Reaktionen von Eltern auf die Autismus-Diagnose ihres Kindes sehr individuell aus. In manchen Fällen kann der Weg bis zur offiziellen Diagnose traumatischer sein als die Diagnose selbst. Viele Eltern, mit denen ich gearbeitet habe, berichteten mir, dass sie gut zehn Ärzte aufsuchen mussten, bis ihr Kind letztendlich dem Autismusspektrum zugeordnet wurde. Während Ärzte bei klassischeren Symptomen des Autismus mit größerer Sicherheit die Diagnose stellen, lassen sich hochfunktionaler Autismus oder das Asperger-Syndrom nicht so leicht identifizieren. Die resultierenden Verhaltensauffälligkeiten sind subtiler.
Symptome oft nach außen nicht sichtbar
Das nicht immer gleich offensichtliche Erscheinungsbild des Autismus macht es einigen Eltern zusätzlich schwer, die Diagnose zu akzeptieren. Handelt es sich bei dem betroffenen Kind um ihr Erstgeborenes, bemerken sie das abweichende Verhalten unter Umständen nicht einmal, bis ein Arzt sie dann darauf hinweist oder Probleme auftreten – dies geschieht oft erst im Kindergarten. Manche Eltern empfinden einen schmerzlichen Verlust ob des „perfekten“ Kindes, das sie meinen, verloren zu haben. Es fällt ihnen schwer, anderen die Diagnose zu erklären, da die Symptome sehr unscheinbar wirken können. Darüber hinaus kann es eine große Herausforderung darstellen, wenn der Nachwuchs sich scheinbar normal entwickelt und plötzlich eine Fähigkeit, wie z.B. das Sprechen, wieder verliert. Eltern geben sich möglicherweise selbst die Schuld dafür, dass ihr Kind autistisch ist. Sie haben das Gefühl, als Eltern versagt zu haben. Daher ist es äußerst wichtig, dass Ärzte sehr sensibel vorgehen, wenn sie die Diagnose überbringen. Sie müssen zuvor sichergestellt haben, dass den Eltern die nötige Unterstützung zur Verfügung stehen wird.
Obwohl Untersuchungen nahelegen, dass sich der Grad der Unterstützung, die eine Familie erhält, darauf auswirkt, wie sie den Autismus des Kindes aufnehmen, muss das Thema Unterstützung vorsichtig gehandhabt werden. Bei den Eltern darf nicht der Eindruck entstehen, dass ihre elterlichen Instinkte unzureichend wären. Erlernte Hilflosigkeit wäre die Folge. Es ist eine Tatsache, dass Eltern im Gegensatz zu ausgebildeten Fachleuten nicht das Wissen haben, um ein Kind mit Autismus fachgerecht zu unterstützen – doch viele Aspekte des Umgangs mit autistischen Kindern beruhen einfach auf guten Erziehungsmethoden. Fachpersonal auf diesem Gebiet sollte die Eltern also darin bekräftigen, ihren Instinkten zu vertrauen, es sollte die elterlichen Stärken hervorheben und ihnen geeignete Literatur, Anlaufstellen und weitere Unterstützung anbieten.
Nicht alle Eltern reagieren bestürzt, wenn bei ihrem Kind Autismus diagnostiziert wird. Viele sind erleichtert, dass es endlich offiziell ist, da sie vielleicht schon Monate oder in vielen Fällen Jahre vor der Diagnose diese Vermutung hatten. Doch auch diese Gruppe von Eltern benötigt Hilfe, wenn es um praktische Aspekte wie häusliche Betreuung oder schulische Maßnahmen geht. Einige Eltern sind zu Anfang in der Lage, ihrem Kind die Förderung zu geben, die es braucht, erkennen jedoch nach einer Weile, dass sie doch Hilfe in Anspruch nehmen möchten. Daher ist es sehr wichtig, dass Ärzte, anderes Fachpersonal und entsprechende Betreuungseinrichtungen flexibel auf die Bedürfnisse dieser Familien eingehen.
Das Labyrinth von schulischen Einrichtungen und Förderung
Nachdem die Diagnose Autismus gestellt worden ist, verwenden Eltern oft sehr viel Zeit darauf, die besten Fördermöglichkeiten für ihr Kind zu finden. All jene, die Erfahrung auf dem Gebiet der Sonderpädagogik oder des Autismus haben, wissen, wie schwierig es ist, die beste Entscheidung hinsichtlich angemessener Fördermaßnahmen zu treffen. Welcher Schultyp passt zu meinem Kind? Soll es auf eine normale oder auf eine Förderschule gehen? Welche Maßnahmen werden die besten Resultate bringen? Welche Therapien sollte mein Kind erhalten? Eltern werden mit all diesen Fragen konfrontiert, zu denen es sehr wenige unvoreingenommene, wissenschaftliche Studien gibt, die ihnen bei der Entscheidung helfen könnten. Was sie aber immer und immer wieder hören, ist die Aussage, dass das Kind so früh wie möglich gefördert werden sollte, was den Druck auf die Eltern nur noch erhöht.
Auch wenn die Eltern die richtigen Entscheidungen getroffen haben, stehen ihnen die gewünschten Förderungsmaßnahmen nicht automatisch auch zur Verfügung. Wartelisten können sehr lang sein oder Aufnahmekriterien so streng, dass das Kind sie nicht erfüllt. Familien bringen oft große finanzielle Opfer, um ihrem Kind die beste Förderung zu sichern, und einige dieser Programme verlangen den Eltern regelmäßig außerordentliche Leistungen ab. Dies kann sich auf die Familiendynamik auswirken und die Eltern daran hindern, ihren anderen Kindern genügend Aufmerksamkeit zu schenken. Sonderpädagogen müssen stets im Hinterkopf behalten, dass das autistische Kind, um das sie sich kümmern, auch immer Teil einer Familie ist. Wie Bronfenbrenner in seinem ökosystemischen Ansatz aufzeigt, wirken sich Veränderungen in der Familiendynamik auf das Erlebnis des Kindes und damit seine Entwicklung aus.
Soziale und kulturelle Wahrnehmung
Individuelle Erfahrungen werden oft davon beeinflusst, wie Menschen im Umfeld der Person auf sie reagieren – die Gesellschaft oder das Makrosystem, wie Bronfenbrenner es nennt. Viele Eltern, mit denen ich gearbeitet habe, fanden es schwieriger, mit den Reaktionen ihres erweiterten Familienkreises und der Gesellschaft im Allgemeinen umzugehen, als mit dem Autismus ihres Kindes an sich. Autismus hat in der Gesellschaft in den letzten Jahren dank Medienpräsenz stark an Bekanntheit zugenommen. Während fast jeder das Wort Autismus schon einmal gehört hat, gibt es jedoch noch immer große Unterschiede, was das adäquate Verständnis für diese Entwicklungsstörung angeht. Zudem lassen sich die Menschen von Stereotypen beeinflussen, die sie in den Medien präsentiert bekommen. Einige Eltern erzählten mir, dass Menschen in ihrem Umfeld sich nicht davon abbringen ließen zu glauben, dass das autistische Kind lediglich frech wäre. Andere berichteten von Leuten, die enttäuscht reagierten, weil das Kind keine außergewöhnlichen Fähigkeiten hatte, wie sie es aus dem Fernsehen oder Büchern gewohnt waren.
Unsere Wahrnehmung individuellen Verhaltens wird auch dadurch beeinflusst, was wir als Gesellschaft als wichtig ansehen. Die meisten europäischen Länder werden immer multikultureller, was bedeutet, dass Eltern aus verschiedenen Kulturkreisen Autismus unterschiedlich wahrnehmen und andere Erwartungen bezüglich der gewünschten Unterstützungsoptionen haben. Während es für eine/n Lehrer/in zum Beispiel wichtig sein mag, dass ein Kind sich auf eine Aufgabe konzentrieren kann oder sein fantasievolles Spielen weiterentwickelt, priorisiert die Familie unter Umständen die Fähigkeit des Kindes, an religiösen oder sozialen Treffen teilzunehmen oder seine schulischen Leistungen zu verbessern. Solch unterschiedliche Prioritäten kann die Zusammenarbeit von Eltern und Fachpersonal erschweren.
Wie bekannt Autismus in der Bevölkerung ist, hängt zudem oftmals von den Gesellschaftsschichten ab. Dies kann dazu führen, dass es für einige Eltern sehr viel schwieriger ist, den Menschen in ihrer Umgebung die Autismus-Diagnose ihres Kindes zu erklären. Unter Umständen ist auch die Fachliteratur in bestimmten Sprachen begrenzt, was den Zugang zu den neuesten Studien erschwert. Es verwundert daher nicht, dass meine Arbeit und Studien gezeigt haben, wie sehr auch kulturelle Faktoren die Akzeptanz einer Diagnose beeinflussen. Das Zurverfügungstellen von Information und relevanten Leistungen spielt eine große Rolle dabei, fachliche Anlaufstellen und unsere Gesellschaft im Allgemeinen im Sinne der Inklusion zu gestalten. Wie ich zu Beginn dieses Blogbeitrags bereits erwähnt habe, empfindet jede Familie das Leben mit einem autistischen Kind auf ihre individuelle Weise. Daher ist es wichtig, neben den grundsätzlichen Aspekten, die es bei der Betreuung zu beachten gilt, immer zuvorderst die Familie als Quelle relevanter Information zu sehen. Sie teilen uns ihre Ängste, Herausforderungen und Prioritäten mit – hören Sie ihr einfach zu.
(Übersetzerin: Julia Welling)
Dr. Prithvi Perepa ist Dozent an der Universität in Northampton. Seit über 20 Jahren arbeitet und forscht er auf dem Gebiet des Autismus. Weitere Informationen zum Autor erhalten Sie hier.
 Im Junfermann Verlag erscheint in Kürze sein Buch Autismus im Kleinkindalter. Professionelle Helfer und auch Angehörige finden hier wichtiges Hintergrundwissen und Übungen, um autistische Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern – empathisch und fundiert dargestellt.
Im Junfermann Verlag erscheint in Kürze sein Buch Autismus im Kleinkindalter. Professionelle Helfer und auch Angehörige finden hier wichtiges Hintergrundwissen und Übungen, um autistische Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern – empathisch und fundiert dargestellt.
Danke, jetzt nicht!
Sei dein eigener Changeman
Von Horst Lempart
Sie sitzen an Ihrem Schreibtisch und ziehen Bilanz. Währenddessen scheint draußen das Leben an Ihnen vorbeizuziehen. Sie versuchen innezuhalten und sich auf den Augenblick zu besinnen. Gleichzeitig werden Sie mit unzähligen Ablenkungen konfrontiert: „Leben ist das, was an dir vorbeizieht, während du Pläne schmiedest“ habe ich neulich auf einem Plakat gelesen. Der Strom des Lebens steht nie still. Wer nicht mitschwimmt oder sich von ihm mitreißen lässt, der bleibt wie ein vertäutes Schiff am Ufer zurück. Ohne seine Bestimmung zu finden, blättert mit der Zeit der Lack ab.
„Change“ ist das Schlagwort unserer Zeit. Veränderung ist alles. Ohne Veränderung ist alles nichts. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Höher, weiter, schneller, unsere Leistung wird an Superlativen gemessen. Heute reicht es eben nicht mehr, ein Star oder Sternchen zu sein. Heute gehört nur Superstars die Zukunft.
Die Produktlebenszyklen werden immer kürzer. Auch kleinste Produktvariationen kommen in immer kürzeren Abständen auf den Markt. Manchmal frage ich mich, worin denn nun überhaupt die entscheidende Verbesserung liegt.
Veränderungsprozesse in Unternehmen sind die Regel, nicht mehr die Ausnahme. Mitarbeiter sind aufgefordert, durch Gesundheitsberatungen, Stress- und Resilienztrainings ihr psychisches Immunsystem zu stärken. Man könnte auch von einem betrieblichen Gesundheits-Changemanagement sprechen. So können Mitarbeiter den Veränderungsforderungen kraftvoller nachkommen.
Durch virtuelle Netzwerke rückt die Welt immer näher zusammen. Mit Internet und Mobilfunk sind wir heute im entlegensten Winkel der Welt erreichbar. Wer sich nicht auf die modernen Kommunikationsmedien einlässt, der scheint den Anschluss an die Gesellschaft zu verlieren.
Unter diesen Gesichtspunkten stelle ich mir die Frage: Wie frei sind wir überhaupt, um über unsere eigene Veränderung zu entscheiden? Neurowissenschaftler gehen einer ganz ähnlichen Frage nach: Wie frei ist unser Wille? Trifft unser Unterbewusstsein unsere Entscheidungen? Als systemischer Coach interessiere ich mich besonders für den Aspekt: Inwieweit ermöglicht uns unsere (System-)Umwelt überhaupt die Entscheidung? Und welche Rolle spiele ich als einzelne Person hierbei? Ich bewege mich hier im Feld der Sozial- und Persönlichkeitspsychologie.
Ein zentrales Bedürfnis des Menschen ist die Zugehörigkeit. Es mag heute nicht mehr überlebenswichtig sein, zu einer Gemeinschaft zu gehören. Aber die Sehnsucht, dabei zu sein, sich angenommen zu fühlen, sich mitzuteilen, Teil eines größeren Ganzen zu sein, ist nach wie vor in uns Menschen tief verwurzelt. Nie war das Angebot an „analogen“ und virtuellen Gruppen größer als heute. „Unter seinesgleichen“ zu sein scheint vielleicht dann umso verlockender, wenn man sich als eigene Persönlichkeit gar nicht mehr richtig erkennt oder wahrnimmt. Dann kann die Gemeinschaft ein Stück Identität zurückverleihen.
Das mag ketzerisch klingen. Soll es auch. Ich bin der Meinung, dass viele Anpassungsforderungen unter dem Deckmäntelchen des „Change“ daherkommen. „Change dich so, dass es für uns passt, dann passt das schon.“ Wir sollen passen: In die Organisation, in den Markt, in das politische System, in die Peergruppe. Selbst Familie und Partnerschaft scheinen in vielen Fällen heute die „Passung“ als übergeordnetes Ziel zu definieren. Verändern wir uns, um zu passen? Ist Change die ökonomische Form einer gesellschaftlich längst akzeptierten Gleichmacherei?
Ich möchte Sie dazu animieren, auch die Phasen des „Stillstandes“ als Wert zu entdecken. Ich meine damit ausdrücklich nicht die Erholungszeiten im Urlaub, das Besinnungswochenende im Kloster oder das autogene Training nach Feierabend. Ich meine auch nicht die Fünf-Minuten-to-go-Mediation. All diese Maßnahmen verfolgen in der Regel das gleiche Ziel: Uns ausreichend gut vorzubereiten für den nächsten Wandel. Als Phase des Nicht-Wandels meine ich die ganz bewusste Entscheidung, die Dinge zu lassen, wie sie sind. Sich auf das zu besinnen, was ist. Vielleicht ganz einfach zufrieden und dankbar dafür zu sein. „Nein“ sagen zu können und zu betonen: „Danke, jetzt nicht“ oder „Das passt nicht zu mir“.
In meinem Buch Das habe ich alles schon probiert gehe ich auf den großen Wert der Dauerhaftigkeit ein. Die Dauer scheint in unserer schnelllebigen, getriebenen Gesellschaft keine große Lobby mehr zu haben. Dabei kann es wichtig, manchmal sogar äußerst vorteilhaft sein, alles zu lassen, wie es ist. Sie kennen das, wenn die Zeit nicht reif ist. Oder wenn die Lösung schlimmer ist als das Problem. Oder wenn die Vorteile des Status quo bei genauerer Betrachtung doch größer sind als die Nachteile.
Es gibt eine ganze Anzahl von Gründen, warum sich Menschen mit Veränderungen schwertun. Sieben davon habe ich in meinem Buch vorgestellt. Diese „Ketten“, die zur Nicht-Veränderung zum „Un-Change“ führen, erfüllen wiederum einen Sinn. Und genau darum geht es im Kern: Veränderung muss für den einzelnen Menschen einen Sinn machen, er muss den Wandel als sinnvoll erleben. Change without sense is Nonsens.
Die große Psychoanalytikerin Ruth Cohn formulierte für ihre Themenzentrierte Interaktion (ein Arbeitsmodell für Gruppen mit dem Ziel der persönlichen Entwicklung) die Grundhaltung: Sei dein eigener Chairman. Damit ist die Aufforderung verbunden, sich selbst, andere und die Umwelt in den Möglichkeiten und Grenzen wahrzunehmen und jede Situation als ein Angebot für die eigene Entscheidung anzusehen.
Wie wäre es also mit: Sei dein eigener Changeman!
Wenn es für Sie griffiger ist: Werden Sie Ihr eigener Changemanager.
Es gehört manchmal eine größere Portion Mut dazu, „Mache ich nicht mit“ zu sagen, als sich gleich zu „changen“. Fragen Sie sich auch durchaus: Wer hat das größte Interesse an Ihrer Veränderung? Sie selber oder irgendjemand anderes?
Vielleicht ist Ihre Entscheidung, beim nächsten Change einfach mal „Nein“ zu sagen, eine ganz neue Erfahrung für Sie. Dann werden Sie merken, dass auch in dieser neuen Erfahrung der Zauber der Veränderung liegen kann, in Ihrer Veränderung.
Horst Lempart ist Coach, psychologischer Berater und NLP-Master. Sein Lieblingstitel ist aber „Persönlichkeitsstörer“. Er lebt und arbeitet in eigener Praxis in Koblenz. 2015 stieß sein Buch Ich habe es doch nur gut gemeint, in dem die narzisstische Kränkung in Coaching und Beratung thematisiert wird, auf großes Interesse. Am 22. Juli erscheint sein neues Buch: Das habe ich alles schon probiert. Warum wir uns mit Veränderung so schwertun. 7 Chains to Change.
An der Grenze der Belastbarkeit
Hilfe zur Selbsthilfe – auch für Flüchtlingshelfer
Von Ludger Brenner
Es war eine spontane Idee, die Daniel Paasch Anfang des Jahres ereilte. Inspiriert von der nahezu grenzenlosen Hilfsbereitschaft, die Menschen in ganz Deutschland zeigten, um den Flüchtlingen ein herzliches Willkommen zu bereiten, wollten er und sein Team den Helfern selbst zu mehr Rückenwind verhelfen. Aus eigener Erfahrung wusste der Lehrtrainer, dass bewegte und bewegende menschliche Schicksale Spuren bei denjenigen hinterlassen können, die sich für andere einsetzen. Somit entwickelte er das kostenfreie Kurzzeitseminar zum Integrationscoach, was vor allem eines leisten sollte: Hilfe zur Selbsthilfe.
Schon 2014 besuchte der Gründer der Akademie für Potenzialentfaltung in Münster die türkisch-syrische Grenze auf Einladung einer Hilfsorganisation. Paasch schulte dort Betreuer, die sich um 25000 jugendliche Flüchtlinge kümmern mussten. „Sie können sich denken, dass die Erlebnisse der jungen Menschen, die ihre Heimat und sogar ihre Familien verlassen mussten, sehr bewegend sind. Wenn auf einmal so viel Leid auf dich hereinbricht, hinterlässt das Spuren. Nicht jedem Helfer gelingt es, dann nach Hause zu gehen und das Erlebte einfach auszublenden. Auch brauchte es Methoden für die Flüchtlinge selbst, die in relativ kurzer Zeit eine spürbare Veränderung zum Positiven bringen sollten. Und da verfügen wir als Kinder- und Jugendcoaches über ein reichhaltiges Portfolio, das sowohl dafür geeignet ist, seinen eigenen State of Mind zu verbessern als auch anderen Menschen wirkungsvolle Unterstützung zu bieten“, berichtet Daniel Paasch.
Es lag also nahe, für diejenigen, die nun in Deutschland eine vergleichbare Situation erleben, ein Angebot zu schaffen. Auch wenn die Emigranten bei uns in Sicherheit sind, können kleinste Auslöser dafür sorgen, dass sich die Erlebnisse aus der Heimat plötzlich einen Weg nach außen bahnen. Die damit verbundenen Emotionen drängen ans Licht. So kann es beispielsweise sein, dass ein Flüchtling, überwältigt von seinen Gefühlen, sein Zimmer zerlegt, und die Außenstehenden haben keine Erklärung, wie es dazu kommen konnte.
 „Alles, was wir erfahren oder erleben, unterliegt einer emotionalen Bewertung durch unser Gehirn“, erklärt der Lehrtrainer. „So wie die eigentliche Informationsaufnahme über unsere Sinneskanäle verläuft, so wird auch die Erinnerung mit sinnesspezifischen Parametern verknüpft. Wir haben es also mit Erinnerungsfragmenten zu tun, die sich zum Beispiel aus auditiven, visuellen oder olfaktorischen (= der Geruchssinn) Einzelteilen zusammensetzen. Treffen wir während des Alltags auf einen Reiz, der einen oder mehrere dieser Erinnerungsfragmente anspricht, kann es sein, dass auch das zugehörige Gefühl abgerufen wird. Meine Großmutter fühlte sich beispielsweise bei dem Anblick von den sich bewegenden Flutlichtern, die man heute häufig, um Aufmerksamkeit zu wecken, vor Diskotheken oder Sportarenen aufstellt, an die Flagabwehr des letzten Krieges erinnert. Aus diesem Grund ist sie nie gerne in die Stadt gefahren“, veranschaulicht er.
„Alles, was wir erfahren oder erleben, unterliegt einer emotionalen Bewertung durch unser Gehirn“, erklärt der Lehrtrainer. „So wie die eigentliche Informationsaufnahme über unsere Sinneskanäle verläuft, so wird auch die Erinnerung mit sinnesspezifischen Parametern verknüpft. Wir haben es also mit Erinnerungsfragmenten zu tun, die sich zum Beispiel aus auditiven, visuellen oder olfaktorischen (= der Geruchssinn) Einzelteilen zusammensetzen. Treffen wir während des Alltags auf einen Reiz, der einen oder mehrere dieser Erinnerungsfragmente anspricht, kann es sein, dass auch das zugehörige Gefühl abgerufen wird. Meine Großmutter fühlte sich beispielsweise bei dem Anblick von den sich bewegenden Flutlichtern, die man heute häufig, um Aufmerksamkeit zu wecken, vor Diskotheken oder Sportarenen aufstellt, an die Flagabwehr des letzten Krieges erinnert. Aus diesem Grund ist sie nie gerne in die Stadt gefahren“, veranschaulicht er.
Wir alle haben wahrscheinlich schon mal die Erfahrung gemacht, dass sich Emotionen auf unterschiedlichste Art und Weise äußern können. Daher ist es zunächst auch für Außenstehende nachvollziehbar, wenn zum Beispiel das Geräusch des Kickerspiels in der Flüchtlingsunterkunft an das Gewehrfeuer erinnern kann, dem ein Neuankömmling vielleicht nur um Haaresbreite entronnen ist. Da sich Erinnerungen aber auf eine sehr gefühlsbetonte oder affektive Weise entladen können – wie der Effekt des harmlosen Kickerspiels zeigt –, stehen Helfer dem zunächst meist machtlos gegenüber: Sie haben ja keine Ahnung von dem, was sich gerade im Kopf des Anderen abspielt, und können es auch nicht wirklich nachvollziehen.
Viele Helfer nehmen das Erlebte mit nach Hause und sehen sich dann oft selbst der Herausforderung gegenüber, ihre Eindrücke verarbeiten zu müssen. Das ist nicht immer leicht. Auch die kulturellen Unterschiede machen es nicht einfacher. All das ist kräftezehrend und bringt Menschen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit.
Seit dem Start des dreitägigen Kurzzeitseminars im Februar 2016 haben über 700 Teilnehmer das Angebot genutzt. Die Zahl spricht für sich und zeigt, dass Daniel Paasch damit einem wichtigen Bedürfnis nachgekommen ist.
Damit noch mehr Menschen hiervon profitieren können, werden auch weiterhin Seminare zum IPE-Integrationscoach angeboten. So kann man sich gegenwärtig noch Plätze in den Städten Köln, Hannover, Hamburg, Stuttgart, Nürnberg und München sichern. Dabei stehen die Türen jedem offen, der mit Flüchtlingen arbeitet oder sich hauptberuflich mit dem Thema Integration beschäftigt.
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung findet man auf der dafür eigens erstellten Webseite www.integrationscoach.org. Fragen zur Ausbildung werden gerne direkt durch das Büro in Münster beantwortet (Tel.: 0251 39729756).
 Ludger Brenner ist Leiter des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit, Presse und Kommunikation am Institut für Potenzialentfaltung. Er arbeitet eng zusammen mit Daniel Paasch, dem Gründer des Instituts und Autor des Buches Potenziale enfalten – Begabungen fördern (2016).
Ludger Brenner ist Leiter des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit, Presse und Kommunikation am Institut für Potenzialentfaltung. Er arbeitet eng zusammen mit Daniel Paasch, dem Gründer des Instituts und Autor des Buches Potenziale enfalten – Begabungen fördern (2016).
In der Kürze liegt die Würze?!
Wie lang ist kurz?
Von Ruth Urban
Wie lang ist die richtige Länge für einen Blog-Artikel? Kurz.
Das ist meine erste, zugegeben pauschale Antwort. In einem Gespräch mit Tanja [Klein] und zwei bloggenden Kunden kamen wir auf folgende, einfache Aufteilung:
– Sie wollen einen Impuls geben, eine Idee anreißen?
Ihr Blog-Artikel muss pointiert sein. Neugierde auf ein Thema, Lust zur Beschäftigung damit und einen wirklichen Anstoß erreichen Sie mit Blog-Artikeln, die wirklich kurz sind, nicht länger als eine halbe DIN-A4-Seite.
– Sie möchten einen Tipp weitergeben?
Wenn Sie Nutzen stiften oder ein Buch, einen Artikel empfehlen wollen, dann sind Sie „expertiger“ unterwegs und Ihr Beitrag kann etwa eine Dreiviertelseite lang sein.
– Sie können eine spannende Geschichte erzählen oder können einen großen Mehrwert für Ihre Leser stiften?
Dann können Sie – gut strukturiert – die Länge einer ganze DIN-A4-Seite nutzen.
Dieses grobe Raster ist nur eine Richtschnur! Doch Sie haben sicher auch schon beobachtet, dass wir uns bei Artikeln von Experten „automatisch“ mehr Zeit nehmen. Wenn lustige oder unwichtige Informationen so sperrig verpackt wären wie manches Wissenswerte, würden wir uns das nicht antun. Bei diesen Inhalten muss die Pointe sehr schnell erfolgen, sonst sind wir – weg. Bei einem Fachartikel haben wir mehr Durchhaltevermögen und unser Gehirn „kalkuliert“ das schon vor Lesestart mit ein. Großartig trotzdem, dass es den Besten auch dort gelingt, die Inhalte kurzweilig aufzubereiten! Denn auch Sie wissen: In der Kürze liegt die Würze.
Ich ergänze: Zumindest online. Und ach, dieser Artikel ist eine Dreiviertelseite lang. Sowas… 🙂
(Erstmals publiziert am 23. Februar 2016 unter www.coachyourmarketing.com)
Ruth Urban ist Expertin für authentisches Marketing & Direktmarketing. Sie arbeitet als Werbetexterin, und gemeinsam mit ihrer Kollegin Tanja Klein unterstützt sie mit ihren Seminaren und Texten Freiberufler dabei, authentisch für sich zu werben.
Tanja Klein arbeitet als systemischer Coach (DCV) in Bonn.
Nach Coach, your Marketing (2012) erscheint am 24. Juni das aktuelle Buch der beiden Autorinnen: Erfolg durch Positionierung.
Ich habe mich mehr auf zu Hause gefreut als das vorzeitige Aussteigen zu bedauern
Die einen sind mit religiösem Eifer dabei, die anderen reizt die sportliche Leistung oder die Herausforderung, mit dem Wenigsten auszukommen und einmal ganz mit sich allein zu sein. Keine Frage: Pilgern entwickelt sich zum Trend. Unser Autor Horst Lempart, ein passionierter Wanderer, hat das Pilgern ebenfalls für sich entdeckt. Das dachte er zumindest. Nach einigen hundert Kilometern stellte er dann aber fest: Einfach nur durchhalten wollen, einfach nur ankommen wollen – das kann es nicht sein! Die Erkenntnis wuchs: Wer A sagt, muss nicht unbedingt auch B sagen. Er kann stattdessen erkennen, dass A falsch war.
Manchmal braucht es eben einen langen (unbequemen) Weg, bis man versteht, was zu einem passt und was einem guttut. Eine kleine Rückschau:
Vom Jakobsweg auf den Holzweg und zurück
Warum ich Wandern dem Pilgern vorziehe
Von Horst Lempart
Ja, ich bin gepilgert. Und nein, ich bin nicht bis Santiago des Compostela gelaufen. Meine Erkenntnisse stellten sich schon früher ein, sodass ich nach etwa 300 Kilometern meinen Fußweg beendet habe.
Von Bilbao bis kurz vor Gijon hat es gedauert, bis ich wusste: Pilgern ist nichts für mich. Vielleicht hätte ich mich leichter getan, ich hätte von Anfang an von Wandern gesprochen statt von Pilgern. Dann hätte es für mich möglicherweise eine andere emotionale Aufladung gegeben. So aber: Ich fühlte mich unbeteiligt, irgendwie nicht so richtig zu den anderen Pilgern dazugehörig. Über spirituelle Erfahrungen hätte ich mich gefreut, ich habe mir sie sogar gewünscht. Aber das Einzige, was meinen Geist wirklich regelmäßig beschäftigte, war die Frage nach dem Ankommen. Dabei soll auf dem Jakobsweg doch der Weg das Ziel sein.
Ich wandere gern und viel. Beim Wandern dosiere ich den Umfang allerdings so, dass das Ende der Wegstrecke rechtzeitig vor der Unlust erreicht ist. Das fiel mir beim Pilgern schwer. Wer in einem festgelegten Zeitrahmen 800 Kilometer zu Fuß schaffen und Santiago erreichen möchte, der geht auch weiter, wenn es keinen Spaß mehr macht. Aber ich hatte Urlaub, und meine Absicht war, Spaß zu haben!
Ich hatte spannende Begegnungen mit tollen Menschen. Jeder hatte unterschiedliche Motive für seinen Pilgerweg, der mit viel Energie und teilweise auch Leid verbunden war: Ein Mädel hatte derart aufgescheuerte Hacken, dass sie die Fersen mit Kortison behandeln musste. Drei Tage Auszeit, nichts ging mehr. Andere Pilger freuten sich auf die Wettervorhersage: In zwei Tagen wird der Regen wärmer. Macht nichts, da muss man als Pilger eben durch.
Nein, sagte ich mir, ich will da nicht durch. Auch wenn ich wind- und wetterfeste Kleidung trage, ich finde Pilgern im strömenden Regen einfach scheiße. Außerdem will ich in meinem Urlaub einfach nicht „müssen“, sondern Dinge tun, die mir Spaß machen:
- Gefühlte 200 Kilometer auf Asphalt laufen machte mir keinen Spaß.
- In Mehrbett-Zimmern das Furzen und Schnarchen anderer miefender Pilger zu ertragen machte mir ebenfalls keinen Spaß.
- Zwei Wochen aus dem Rucksack zu leben und dabei mit ganzen zwei Wandershirts, zwei Unterhosen und zwei Paar Socken auszukommen machte mir bald auch keinen Spaß mehr.
- Morgens um sechs Uhr aufstehen zu müssen, damit man die Tagesetappe frühzeitig schafft, um einen Herbergsplatz zu ergattern, empfand ich auch nicht als die reine Erholung.
Ich bin die Nordroute gegangen, den „Camino del Norte“ an der spanischen Atlantikküste entlang. Die Landschaft ist einfach klasse: Herrliche Strände, beeindruckende Steilküste, zarte Hügellandschaften und malerische Dörfer. Eine Reise dorthin, wo Spanien am grünsten ist, lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde die Gegend in einem weiteren Anlauf aufs Neue für mich entdecken. Nicht in diesem Jahr, und auch nicht im nächsten. Denn ich bin auch Pinchos-satt. Kleine Appetit-Häppchen auf dem immer gleichen Weißbrot konnte ich nach acht Tagen nicht mehr sehen. Ich liebe die deutsche Brotvielfalt und einen reich gedeckten Frühstückstisch. In den Herbergen gab es morgens Toastbrot, Marmelade und Hartkekse.
Nach zehn Tagen des Unterwegsseins hatte ich für mich entschieden, die Rückreise anzutreten. Von dem Moment an habe ich mich mehr auf zu Hause gefreut als das vorzeitige Aussteigen zu bedauern. Rückblickend war es für mich auch kein Abbruch, sondern ein frühzeitiges Ankommen. Ich habe für mich selbst gut gesorgt, und das ist für mich eine der wesentlichen Fähigkeiten auf dem Weg der persönlichen Entfaltung.
Über den Autor
Horst Lempart, Jahrgang 1968, ist Business-Coach in eigener Praxis in Koblenz. In der Rolle des „Persönlichkeitsstörers“ beunruhigt er Systeme und macht dadurch Entwicklung möglich. Im letzten Jahr erschien sein Buch „Ich habe es doch nur gut gemeint – Die narzisstische Kränkung“. In Kürze ist sein neues Buch Das habe ich alles schon probiert. Warum wir uns mit Veränderung so schwertun. 7 Chains to Change im Handel erhältlich.
Weitere Informationen zum Autor und seiner Tätigkeit erhalten Sie hier.