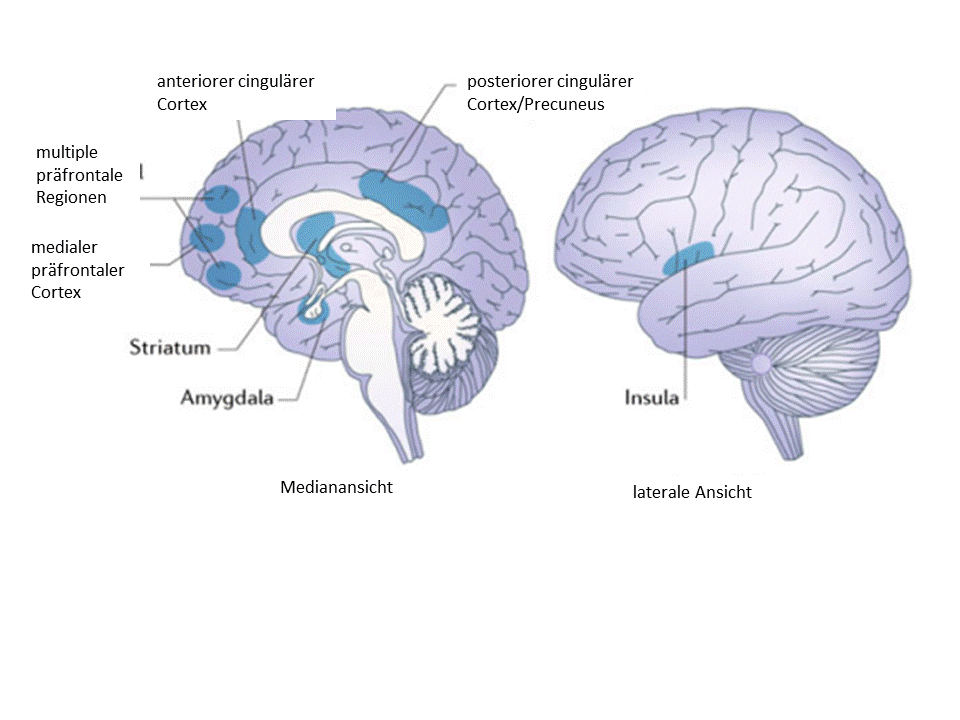Zu Hause werden die Türen geknallt: Ein Streit, der harmlos begonnen hatte, ist eskaliert. Ein klärendes Gespräch? Unmöglich!
Im Meeting wird es plötzlich lauter. Ein Wort gibt das andere, bis ein Kollege wortlos aufsteht und geht.
Über den Gartenzaun hinweg diskutieren zwei Nachbarn miteinander. Beide halten ihre Emotionen zurück, doch in ihnen brodelt es.
Konflikte sind in unserem Leben unvermeidbar. Überall und jederzeit können sie auftreten. Die meisten von uns scheuen sie und drücken sich vor einer Austragung. Was dabei zu wenig im Fokus steht: die Chancen, die sich uns bieten.
 Dr. Karim Fathi ist zertifizierter Konfliktberater und an der Akademie für Empathie in Berlin tätig. In seinem neuen Buch Das Empathietraining vermittelt er Konzepte aus den Bereichen Coaching und Beratung. Er richtet sich damit an alle Menschen, die ihre Empathiefähigkeit verbessern möchten, um sich fit für Krisen und Konflikte zu machen.
Dr. Karim Fathi ist zertifizierter Konfliktberater und an der Akademie für Empathie in Berlin tätig. In seinem neuen Buch Das Empathietraining vermittelt er Konzepte aus den Bereichen Coaching und Beratung. Er richtet sich damit an alle Menschen, die ihre Empathiefähigkeit verbessern möchten, um sich fit für Krisen und Konflikte zu machen.
Herr Fathi, Sie haben ein beeindruckendes Profil: Unter anderem sind Sie Friedens- und Konfliktforscher. Wie sieht als solcher Ihr Arbeitsalltag aus? Und wie kamen Sie zu dieser Profession?
Während meines Studiums der Friedens- und Konfliktforschung an der Philipps-Universität Marburg war es stets mein Traum, an der Lösung der großen internationalen Konflikte in der Welt mitzuwirken. Ich begann nach dem Studium eine einjährige Ausbildung zum Konfliktberater bei Johan Galtung, einem der Gründerväter der Friedensforschung, der schon damals Erfahrung als Mediator in über 120 internationalen Konflikten hatte. Meine ersten Schritte tat ich danach ab 2009 als Mitarbeiter an zwei Instituten, die zu internationalen Konflikten forschen und beraten: Berghof Conflict Research in Berlin und International Institute for Conflict in Wien (Letzteres existiert heute nicht mehr und ist in das in Jerusalem ansässige Herbert C. Kelman Institute übergegangen). Ich war total fasziniert zu beobachten, dass auch in den komplexesten und gewalttätigsten Konflikten alle Parteien im Grunde „gute“, legitime Motive hatten. Ob südamerikanische Rebellengruppen, westafrikanische Warlords, islamische Extremisten aus dem Nahen Osten oder die Armeen der jeweiligen Regierungen, mit denen sie Krieg führten – trotz ihrer destruktiven Energie und gegensätzlichen Zielsetzungen offenbarten alle Vertreter/-innen im Grunde nahezu identische Bedürfnisse. Sie alle redeten davon, dass sie zwar Krieg führten, aber eigentlich Frieden, Sicherheit für ihre Angehörigen, Ausgleich für erlittene Ungerechtigkeiten, Respekt etc. wollten. Da erkannte ich: Jeder Konflikt ist im Grunde lösbar und zwar so, dass alle Seiten zufriedengestellt sind. Aber ich war auch ernüchtert festzustellen, dass man in der Praxis als Konfliktberater großer internationaler Konflikte wenig Einflussmöglichkeiten hat. So laufen die Konflikte in Nahost seit Ewigkeiten und ohne entscheidenden Durchbruch weiter, trotz über 30.000 Hilfsorganisationen alleine in Israel-Palästina. Und wenn Konflikte doch gelöst werden – dann so, dass sich die Konfliktarbeiter/-innen fragen mussten, ob ihre jahrelange Arbeit irgendeinen Sinn hatte. Das konnte ich in Bezug auf den Bürgerkrieg in Sri Lanka miterleben. Der Konflikt fand zwischen den für die Unabhängigkeit kämpfenden Tamil Tigers und der singhalesischen Regierung statt. Er dauerte seit 1983 an und wurde 2009 jäh mit einem Vernichtungsschlag der Regierungstruppen beendet. Zehntausende Menschen, vor allem Zivilisten, fanden den Tod. Meine Kolleg/-innen, die jahrelang vor Ort tätig waren und auf eine konstruktive Lösung hingearbeitet und zwischen den Parteien vermittelt hatten, waren völlig desillusioniert.
Ich war total fasziniert zu beobachten, dass auch in den komplexesten und gewalttätigsten Konflikten alle Parteien im Grunde „gute“, legitime Motive hatten.
Diese und andere Erfahrungen führten dazu, dass ich mich intensiv mit der Frage auseinandersetzte, was ganzheitliche Konfliktlösung in Theorie und Praxis ausmacht. Es ist ja nicht so, dass wir heute wenig Wissen und Konfliktlösungsmethoden zur Verfügung haben – im Gegenteil. Aber es gibt dazu kaum Orientierung und bislang hatten sich noch wenige Akademiker/-innen und Praktiker/-innen die Frage gestellt, wie sich dieses Wissen integrieren lässt. Diesen Überlegungen ging ich im Rahmen meiner Doktorarbeit nach, die ich 2011 abschloss. Zugleich begann ich mich als freiberuflicher Berater mehr dafür zu interessieren, wie sich alltägliche, „kleine“ Konflikte, also Konflikte mit den eigenen Kindern, dem Lebenspartner, dem Nachbarn oder Arbeitskollegen besser lösen lassen. Anders als die großen internationalen Konflikte ist wirklich jeder Mensch in seinem Leben davon betroffen. Ich erkannte auch, dass sich die Arbeit als Berater und Coach von beruflichen und privaten Alltagskonflikten als vergleichsweise sinnstiftender erwies: Ich konnte die Prozesse direkt beeinflussen und nach nur wenigen Sitzungen eine für alle Parteien befriedigende Entscheidung herbeiführen. Im vorliegenden Buch ist im Detail einer meiner ersten Fälle beschrieben. Um die Ausgangsfrage zu beantworten: Heute ist mein Arbeitsalltag vor allem damit gefüllt, dass ich als freiberuflicher Berater, Trainer, Dozent und Coach Privatpersonen, Fach- und Führungskräfte, Teams und Organisationen darin unterstütze, ihre kommunikativen Kompetenzen der Konflikt- und Krisenbewältigung zu entwickeln. Daneben forsche und publiziere ich zu der Frage, wie kollektive Systeme, sei es Teams, Organisationen oder Gesellschaften, über die Stellschraube „Kommunikation“ ihre Krisenfähigkeit steigern können. Dazu erscheinen noch in diesem Jahr zwei weitere Bücher von mir.
Was denken Sie: Haben sich zwischenmenschliche Konflikte (im Großen wie im Kleinen) in den letzten Jahren in ihrer Intensität/Häufigkeit etc. verändert?
Ich glaube, zu allen Zeiten und in allen Kulturen haben Menschen Konflikte, und zwar auf allen Eskalationsstufen. In ihrer Häufigkeit haben sie sich sicherlich nicht geändert, denn wann immer Menschen zusammentreffen, treffen auch unterschiedliche Meinungen und Interessen aufeinander, und so entstehen Konflikte. Historisch gesehen, hat die Intensität vielleicht eher abgenommen, wie es z.B. der berühmte Evolutionsexperte und Psychologe Steven Pinker in seinen Büchern beschreibt. Er verdeutlicht meines Erachtens recht plausibel, dass seit der Aufklärung Gewaltherrschaft, Sklaverei, Folter, Tötung aus Aberglauben oder bei Duellen geächtet sind und dass wir – trotz aktueller globaler Konflikte – immer noch in der friedlichsten aller Welten leben. Auch wenn einige Beobachter/-innen in den letzten Jahren von einer Abnahme der Empathie, vermehrtem Ellenbogendenken und einer allgemeinen Verrohung im zwischenmenschlichen Umgang sprechen, glaube ich, dass wir historisch gesehen, in der heutigen Informationsgesellschaft vergleichsweise zivilisierter mit Konflikten umgehen als im Mittelalter.
Trotz aktueller globaler Konflikte leben wir immer noch in der friedlichsten aller Welten.
Aus Ihrer Erfahrung heraus: Sind Menschen prinzipiell friedliebend oder ist ihr Konfliktpotenzial schon besorgniserregend?
Konfliktpotenzial hat es immer gegeben und gleichzeitig auch das Bedürfnis nach Frieden. Wir tragen beides in uns. Wann immer sich Menschen begegnen, gibt es Konfliktpotenzial. Psychologische Experimente, wie z.B. das Stanford Prison Experiment oder das Milgram Experiment, und zuvor schon Hannah Arendts Untersuchungen zur „Banalität des Bösen“ weisen darauf hin, dass wir alle sogar recht grausame Seiten in uns tragen, die in bestimmten Situationen – wenn wir nicht achtsam sind und z.B. Gruppendynamiken nachgeben – zum Tragen kommen können. Es lässt sich also nicht vermeiden, dass wir Konflikte haben und mitunter eine „dunkle Seite“ in uns schlummert. Wollen wir ein friedliches Leben führen, stellt sich vielmehr die Frage, wie wir damit umgehen. Selbst wenn wir zu keiner Lösung kommen, können wir mit Achtsamkeit, Empathie und Gelassenheit konstruktiv mit Konflikten umgehen lernen. Wie wir das kultivieren können, erfahren Sie in meinem Buch.
Woran scheitert Ihrer Ansicht nach der Versuch, einen Konflikt mit einem für alle Beteiligten zufriedenstellenden Kompromiss zu klären?
Grundsätzlich lässt sich jeder Konflikt (und ich behaupte: wirklich jeder Konflikt!) auf mindestens fünf Arten lösen. Erstens einseitig zu Gunsten der einen Partei (100/0-Lösung), zweitens durch Nachgeben zugunsten der anderen Partei (0/100-Lösung), drittens durch Vermeiden bzw. Rückzug (0/0), viertens durch den Kompromiss (50/50) oder fünftens durch kreative Zusammenarbeit (100/100). Die Kompromisslösung ist gar nicht so schwer zu finden und steht häufig am Ende einer Verhandlung oder Mediation, denn sie beinhaltet im Wesentlichen nur, dass beide Parteien Zugeständnisse machen und sich „in der Mitte treffen“. Kreative Zusammenarbeit ist die verhältnismäßig konstruktivste Lösung für alle Beteiligten, aber auch deutlich schwieriger zu erreichen: Sie setzt voraus, dass sich alle Beteiligten wirklich verstehen wollen, dass sie Verantwortung für ihre Handlungen übernehmen und dass sie bereit sind, die Situation aus neuen Perspektiven zu betrachten, um zu entsprechend neuen Lösungen zu kommen. Dies erfordert Empathie, Kreativität und Zeit – Ressourcen, die uns in Konflikten oft fehlen. Wir sind zu gestresst und zu sehr auf unseren empfundenen Verletzungen fixiert. Das ist auch der Fokus des Buches: Wie können wir in stressigen Konflikten Ressourcen aufbauen, um für alle bestmöglich mit der Situation umzugehen?
Wenn Konfliktparteien in einer absoluten Sackgasse stecken – es gibt kein Vor und kein Zurück mehr –, was hilft, um neue Bewegung zu bewirken?
Solche Situationen sind meiner Erfahrung nach schmerzhaft, aber auch sehr chancenreich. Wir können nicht mehr zurück und so weitermachen wie bisher. Wir sind nahezu gezwungen, irgendwas anders zu machen. Aber dieses Neue ist (noch) nicht da und wir wissen vielleicht (noch) nicht, wie es aussehen soll. Ich glaube, in solchen Situationen (typischerweise sprechen wir hier von „Krisen“) können wir an unterschiedlichen Punkten ansetzen. Was wir am ehesten beeinflussen können, sind wir selbst, und damit meine ich unser Denken und Handeln. Manchmal kann es Sinn machen, eine Pause einzulegen, sich aus der Situation zurückzuziehen, bis sich die Gemüter abgekühlt haben. Nach einer Pause kann die Situation in neuem Licht erscheinen. Es gibt eine Fülle von Techniken, wie Sie aus Ihren Denkfallen heraustreten, sich auf das Hier und Jetzt einlassen und zu neuen Perspektiven kommen können und wie Sie sich von stressigen Emotionen befreien können – im Buch werden Sie sorgsam daran herangeführt.
Pragmatismus heißt, alles, was uns hilft, zu nutzen, um die aktuelle Situation ein bisschen angenehmer zu gestalten.
Was sich im zwischenmenschlichen Kontext auch mal empfiehlt, ist reiner Pragmatismus. Wenn wir nicht wissen, was die finale Lösung sein könnte, können wir vielleicht zu schrittweisen, temporären Übergangslösung kommen. Wenn wir uns nicht über den Inhalt der Lösung einigen können, können wir uns vielleicht zumindest über den Prozess einigen, also, wie wir zu einer Entscheidung kommen. Pragmatismus heißt, alles, was uns hilft, zu nutzen, um die aktuelle Situation ein bisschen angenehmer zu gestalten – und sei der Schritt noch so klein. In einem Beziehungskonflikt zwischen Liebenden kann es auch sinnvoll sein, das festgefahrene Konfliktthema kurz zur Seite zu stellen und sich anderweitig anzunähern. Später kann das Paar von einer anderen Ausgangslage heraus gemeinsam auf das Problem schauen. Ich glaube, in jeder noch so festgefahrenen Situation können wir etwas tun. Meist müssen wir die Dinge etwas anders machen oder anders denken als bisher. Ich glaube, es gibt für alles Auswege, wir sind uns ihnen nur nicht immer bewusst.
In Ihrem neuen Buch Das Empathietraining vermitteln Sie konkrete Ansätze und Methoden, um gestärkt aus Beziehungskonflikten hervorzugehen. Wie kamen Sie auf das Thema Empathie und warum sehen Sie darin eine Art Universalkompetenz?
Ausgangspunkt dieses Buches war ein hocheskalierter Konflikt in einer Unternehmerehe, den ich mit meinem Freund und Kollegen, Herbert Haberl, begleiten durfte. Wir hatten glücklicherweise viel Zeit und Ressourcen, um – im Einverständnis mit unseren beiden Klient/-innen – mit verschiedenen Methoden zu experimentieren, also nicht nur dem klassischen Konfliktmanagement, sondern Methoden aus Resilienzförderung/Stressmanagement, systemischem Coaching, Neurolinguistischer Programmierung (NLP), sogar spirituellen Weisheitstraditionen. Am Ende kamen wir nicht nur zu einer Versöhnung, sondern auch zu einer integrierten Kombination unterschiedlicher Traditionen zur Förderung von Krisen- und Konfliktlösungskompetenzen. Die aus diesen Erfahrungen gewonnenen Erkenntnisse führten zur Entwicklung eines ganzheitlichen Empathietrainings und zur Gründung der Akademie für Empathie, einer Sinn- und Arbeitsgemeinschaft mit unterschiedlichen Expert/-innen aus Theorie und Praxis rund um das Thema Empathie. „Empathie“ begreifen wir hier nicht nur als „Einfühlung“ (emotionale Empathie) oder ein „Sich-Hineindenken“ (kognitive Empathie), sondern auch als „Selbstempathie“ (eigene Gefühle und Gedanken wahrnehmen können). In unserer Forschung und Praxis kamen wir zum Ergebnis, dass wir alle eine natürliche, authentische Verbindung zu allen Menschen, im weitesten Sinne zu allem Leben besitzen. Diese Verbindung ist uns nicht immer bewusst, sie ist aber immer da. Wir werden uns ihr vor allem dann gewahr, wenn wir in unserer Mitte sind und uns gelassen und zentriert fühlen. Dies lässt sich unserer Erfahrung nach systematisch fördern. Diese Art von Empathie, die sich ganz natürlich aus unserer Zentrierung ergibt, umschreiben wir arbeitshypothetisch mit „Empathie 3.0“. Sie ist eine Universalkompetenz, weil sie uns ermöglicht, mit vielfältigen unterschiedlichen Problemsituationen souverän umzugehen, ohne dass wir zwingend weiterführende konkretere Kompetenzen erlernen müssen. Kultiviere ich Empathie 3.0 in mir, kann ich souveräner mit Arbeitsstress, Konflikten aller Art, sogar tiefen Lebenskrisen umgehen. Sie hilft Führungskräfte dabei, funktionaler mit ihren Mitarbeitern umzugehen und kann ganze Teams dabei unterstützen, kollektiv intelligenter und damit leistungsfähiger zu werden.
Wie kann Ihr Buch Leser darin unterstützen, empathischer und im positiven Sinne „konfliktfähiger“ zu werden?
Im Zentrum dieses Buches steht das Empathietraining, mit dem Sie Ihre natürliche Empathie und Gelassenheit kultivieren und im Alltag mehr Raum geben können. Das Buch enthält mehrere, aufeinander aufbauende Übungen, die im Durchschnitt etwa fünf bis zehn Minuten Praxis pro Tag erfordern. Veranschaulicht werden die Übungen und darin enthaltenen Methoden anhand von vielfältigen Beispielen aus meiner Beratungspraxis. Über einem Zeitraum von ungefähr zwei Monaten praktiziert, führt das Trainingsprogramm zu einer Steigerung Ihrer Empathie, Stress- und Konfliktfähigkeit. Ähnlich wie auch beim Sport/Fitness braucht es aber gewisse Kontinuität über einen längeren Zeitraum.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Stress der Empathiekiller Nummer 1 sei. Das ist fatal, denn wir leben gewissermaßen in einer „gestressten Gesellschaft“. Welche Auswirkungen hat unser Lebenstempo auf das Miteinander?
Stress hat es schon immer gegeben und führt uns evolutionär gesehen zu Höchstleistungen an. Doch wenn wir gestresst sind, neigen wir dazu, selbstbezogen zu sein und wir haben wenig Ressourcen, uns empathisch auf andere einzulassen. Die Psychologin Sara Konrath beschrieb in ihrer vielzitierten Studie das „Empathieparadoxon“, wonach die Menschen infolge der Globalisierung zwar mehr miteinander verbunden seien, aber zugleich zwischenmenschliche Empathie abnehmen würde. Das Problem unserer Zeit ist der empfundene Dauerstress infolge von Informationsüberflutung, Leistungs-, Konsum- und vor allem Zeitdruck. Viele Menschen haben verlernt abzuschalten und sind in einem permanenten Erregungszustand, der ihr Alltagshandeln und -denken negativ beeinflusst. Indem wir also lernen, funktionaler mit den Anforderungen der Informationsgesellschaft umzugehen und uns nicht dauerhaft stressen zu lassen, werden wir gelassener und empathischer. Es ist interessant zu beobachten, dass sich gerade in der schnelllebigen Zeit von heute deutliche Gegentrends nach Entschleunigung und Gelassenheitsförderung abzeichnen. Yoga, Meditation, Wellness etc. sind heute keine exotischen Begriffe mehr, sondern verbreitete Antworten auf den empfundenen Dauerstress unserer Zeit. Vor diesem Hintergrund leistet mein Buch auch einen Beitrag, gelassener, empathischer und konfliktfähiger in unserer gestressten Gesellschaft zu sein.
Was tun Sie persönlich gegen Stress?
Ich wende viele der im Buch beschriebenen Methoden selber an. In stressigen Situationen kommuniziere ich gerne lösungsorientiert (Konfliktkommunikation), darüber hinaus setze ich mich mit meiner Wahrnehmung des stressigen Ereignisses auseinander (mentale Techniken) und lasse negative Gefühle los (emotionale Techniken). Manchmal reicht es schon, ein paarmal tief durchzuatmen. Auch sehe ich zu, dass ich stets ausreichend Zeitfenster habe, mich zu regenerieren. Darüber hinaus praktiziere ich täglich mindestens eine Stunde Achtsamkeitsmeditation, was mir besonders gut hilft, klar zu sehen und die vielen kleinen und großen Dinge, die stressig erscheinen, in einen angemessenen Kontext zu setzen. Hier wird mir bewusst, dass es sich bei den meisten Dingen gar nicht lohnt, sich über sie aufzuregen.
Hand aufs Herz: Was bringt Sie selbst so richtig „auf die Palme“? Wo lassen Sie nicht/ungern mit sich verhandeln?
Mich bringt auf die Palme, wenn ich mich mit für mich nicht nachvollziehbaren, kleinteiligen, bürokratischen Prozessen auseinandersetzen muss. Ich habe ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Effizienz und Freiheit und wenn ich in solchen Situationen nicht geistesgegenwärtig bin, habe ich den anhaltenden Gedanken, dass ich dazu gezwungen werde, meine „Lebenszeit zu verschwenden“. Da empfinde ich relativ viel Stress, wahrscheinlich sogar mehr als die meisten Menschen. Ein befreundeter Therapeut hat mal mittels Herzratenvariabilitätsmessung (HRV) meine Lebensfeuerwerte gemessen, als ich meine Steuererklärung gemacht habe: Meine Werte waren völlig im Keller! Als ich Stunden später Gelegenheit hatte, kreativ zu arbeiten und an meinem Buch schrieb, waren meine Werte wieder auf höchstem Niveau.
Ihr Kredo?
Frieden in der Welt beginnt mit Frieden in dir.
Weitere Informationen zum Autor erhalten Sie hier.

Karim Fathi: Das Empathietraining. Konflikte lösen für ein besseres Miteinander.
Das Buch ist ab sofort im Handel erhältlich.