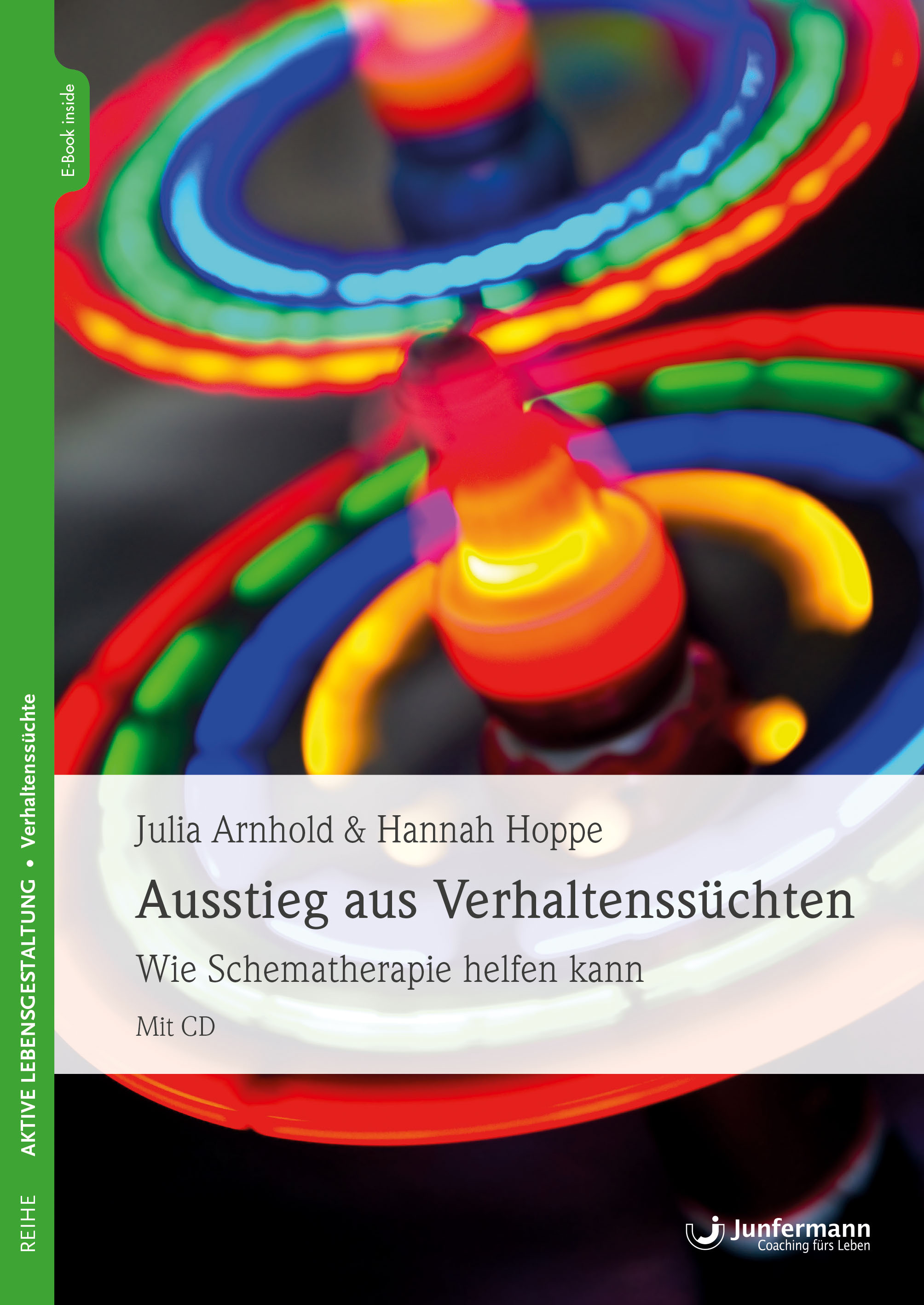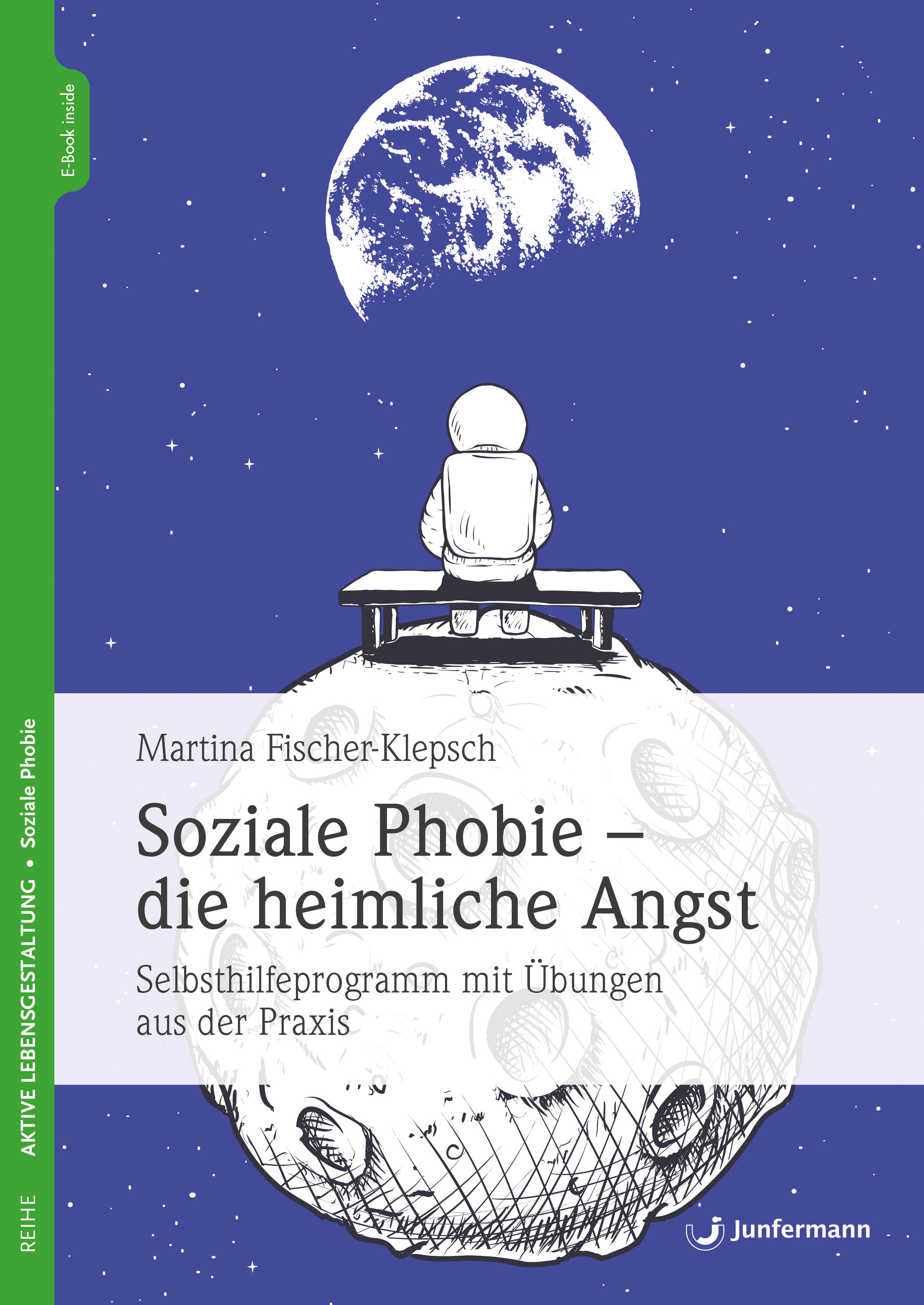 Es gibt wohl kaum einen Menschen, der nicht einmal Angst davor hat, sich zu blamieren, peinlich zu verhalten oder von anderen abgelehnt zu werden. Schüchternheit und leichte Formen von sozialer Unsicherheit sind sehr weit verbreitet. Die Momente von Unbehagen sind dabei zwar nicht angenehm, werden aber bald darauf wieder vergessen. Wenn die sozialen Ängste allerdings häufiger werden, wenn sie mit negativen Gedanken und Bewertungen der eigenen Person verbunden sind, und anfangen, das Leben zu beeinträchtigen, dann wird diese Unsicherheit zu einer Sozialen Phobie.
Es gibt wohl kaum einen Menschen, der nicht einmal Angst davor hat, sich zu blamieren, peinlich zu verhalten oder von anderen abgelehnt zu werden. Schüchternheit und leichte Formen von sozialer Unsicherheit sind sehr weit verbreitet. Die Momente von Unbehagen sind dabei zwar nicht angenehm, werden aber bald darauf wieder vergessen. Wenn die sozialen Ängste allerdings häufiger werden, wenn sie mit negativen Gedanken und Bewertungen der eigenen Person verbunden sind, und anfangen, das Leben zu beeinträchtigen, dann wird diese Unsicherheit zu einer Sozialen Phobie.
Ein Interview mit der Psychologischen Psychotherapeutin Dr. phil. Martina Fischer-Klepsch, Autorin von Soziale Phobie – Die heimliche Angst.
Frau Fischer-Klepsch, was ist eine Soziale Phobie und wie kann sie sich äußern?
Martina Fischer-Klepsch: Soziale Angst ist grob gesagt die Angst vor anderen Menschen, genauer vor Peinlichkeit, Blamage, Entwertung, Demütigung, Herabsetzung. Menschen mit sozialen Ängsten befürchten, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen und negativ bewertet zu werden. Sie nehmen sozusagen die Blamage bereits im Kopf vorweg und stellen sich lebhaft vor, wie peinlich es wäre, wenn sie erröten würden oder in bestimmten Situationen, beispielsweise beim Trinken oder Essen zittern würden. Weit verbreitet ist auch die Angst vor dem Sprechen in kleinen oder größeren Gruppen, nicht nur bei Präsentationen, sondern auch im privaten Bereich. Das kann schon in der Schule beginnen, wenn ein Gedicht aufgesagt oder ein Referat gehalten werden soll. Einige Menschen haben Angst zu telefonieren, was in Zeiten von Textnachrichten gut vermieden werden kann. Einige Betroffene haben Probleme damit, öffentliche Toiletten zu benutzen oder beim Sex zu versagen oder nicht den „Mann“ stehen zu können. Ganz zu schweigen davon, überhaupt ein Date zu haben, sich zu verabreden, essen zu gehen oder an Parties teilzunehmen, einzuladen oder eingeladen zu werden. Es gibt eine Vielzahl von Situationen, die sich kaum vermeiden lassen oder die zur sozialen Isolation führen können. Auch viele berufliche Situationen sind eine Herausforderung für Menschen mit sozialen Ängsten. Die Palette reicht von leichter Schüchternheit beim Kennenlernen über einzelne ängstigende oder verunsichernde Situationen bis hin zu starker Angst und Anspannung in fast allen Kontakten mit anderen Menschen. Das Thema ist ungeheuer komplex und wird auch manchmal von Fachleuten nicht richtig erkannt, weil die Betroffenen ein so ausgeprägtes Vermeidungsverhalten an den Tag legen.
Hat dieses Vermeidungsverhalten nicht gravierende Folgen wie z. B. gesundheitliche Einschränkungen, weil man sich nicht traut, einen Arzt aufzusuchen oder Probleme, eine Arbeit zu finden, weil man das Vorstellungsgespräch scheut?
Ja, das Vermeidungsverhalten bei der sozialen Angststörung, wie die Soziale Phobie in jüngerer Zeit auch genannt wird führt zu gravierenden Konsequenzen im Leben der Betroffenen. Studien zeigen, dass diese Menschen im Beruf häufig hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Angefangen vom Bewerbungsgespräch über Kontakten mit Kollegen bis hin zur Kundenkontakten und Präsentationen sind viele Situationen eine große Herausforderung und werden dementsprechend gemieden. Erschwert wird natürlich auch die Partnersuche, weswegen Menschen mit Sozialen Phobien überdurchschnittlich häufig alleine leben und ohne feste Partnerschaft bleiben. Es kann schon sehr belastend sein, bei einem Date davon auszugehen, dass man unattraktiv, langweilig und inkompetent ist! Arztbesuche werden übrigens auch von Menschen gemieden, die Angst vor der Untersuchung wie Spritzen, Blutentnahmen, Zahnarztbehandlungen haben. Das kommt auch recht häufig vor. Interessanterweise fallen mir gerade keine Patienten ein, die Probleme mit dem Arztbesuch haben, vielleicht, weil sie dort nicht „performen“ müssen, es wird ja nichts von ihnen erwartet! Aber das Telefonieren, ein Anliegen vorbringen fällt vielen sehr schwer. Deshalb schicken mir viele Betroffene auch lieber eine E-Mail, als dass sie anrufen. All das meint eben diejenigen Betroffenen, bei denen die sozialen Ängste sehr ausgeprägt sind und die psychotherapeutischen Behandlungsbedarf haben.
Vielen Menschen mit sozialen Ängsten merkt man die Schwierigkeiten gar nicht an und Sie wären überrascht, wie viele Soziophobiker sich wahrscheinlich in Ihrem Bekanntenkreis finden! Sie machen sich ungeheure Gedanken in bestimmten sozialen Situationen, Sie merken ihnen aber gar nichts an.
Der Titel Ihres Buches lautet: „Soziale Phobie – die heimliche Angst“. Warum „heimliche“ Angst?
Das liegt an der Scham! Die Betroffenen verheimlichen deswegen ihre Ängste und gestehen sie häufig nicht einmal der engsten Bezugsperson. Niemand soll merken, dass sie das Gefühl haben, nicht ok zu sein, sondern makelbehaftet, inkompetent, unattraktiv, uninteressant oder dumm. Das Problem dabei ist, dass diese (falsche!) Selbsteinschätzung so nicht korrigiert werden kann. Das Verheimlichen ist dann auch wieder eine Vermeidung oder ein „Sicherheitsverhalten“, wodurch das „Schlimmste“, nämlich die Demütigung oder Abwertung, sozusagen kaschiert werden soll. Es wird als Schwäche wahrgenommen, sozial unsicher zu sein. Gesunde Menschen akzeptieren ihre Schwächen und Fehler und sind trotzdem der Meinung „im Großen und Ganzen“ in Ordnung zu sein.
Soziophobiker generalisieren ihre Schwäche und betrachten sich global und als ganzen Menschen als „Versager“.
Liegen einer sozialen Phobie immer negative oder abwertende Erfahrungen zugrunde, oder kann sie auch „aus dem Nichts“ kommen?
Keine psychische Störung kommt aus dem Nichts, sondern es gibt immer genügend Gründe und meistens ein ganzer Blumenstrauß an Faktoren, die alle zusammen genommen zu einer sozialen Angststörung führen können, aber nicht müssen. Manche Menschen haben viele Ressourcen und sind „resilient“. Es ist ganz erstaunlich, was manche durchmachen müssen, da wundere ich mich manchmal, dass sie nicht kränker geworden sind. Aber das ist ja ein gutes Zeichen, dass ein gesundes „Naturell“ auch einiges regulieren kann. Es kommt aber auch vor, dass die Kindheit und Jugend gut war, der oder die Betroffene behütet aufgewachsen ist, nach außen alles in Ordnung zu sein schien und trotzdem gibt es dann diese Unsicherheit. Manchmal war die Familie vielleicht auch zu harmonisch und behütend, sodass einfach nicht gelernt werden konnte, mit schwierigen Situationen umzugehen.
Welche Strategien empfehlen Sie – neben einer Therapie oder einem Coaching – um sich einer Sozialen Phobie zu stellen und wieder mehr Lebensqualität zu erlangen?
Sie haben es in Ihrer Frage schon angedeutet: sich der Angst stellen! Das Geheimnis lüften und sich vertrauten Menschen öffnen. Mutig sein, Risiken eingehen. Das Vermeidungs- und Sicherheitsverhalten wahrnehmen und versuchen, es abzubauen. Und sich immer wieder in ängstigende Situationen, am besten gestuft, reinbegeben. Dabei aber wichtig: versuchen, sich nicht zu be- oder verurteilen! Vielmehr sich liebevoll und gütig selbst zureden; auch das ist schwer, aber wichtig, im Hinterkopf zu behalten.
Exposition – die bewusste Auseinandersetzung mit Situationen, die die Phobie befördern – wird häufig empfohlen, um der Angst ihren Schrecken zu nehmen. Wie stehen Sie dazu?
Ich bin trotz Erweiterung meines verhaltenstherapeutischen Ansatzes um die Sicht auf die Biografie und das System, in dem jemand lebt, Achtsamkeit und Meditation und Schematherapie der Meinung, dass Expositionsübungen sehr helfen!
Allerdings ist es wichtig, mit welcher Grundhaltung diese Übungen durchgeführt werden und wie sie „eingebettet“ sind. Wenn jemand „nur“ unter starker Schüchternheit und leichten sozialen Ängsten leidet, dann ist das oben genannte üben, üben, üben sicher eine ganz wichtige Empfehlung. Wichtig ist dabei, schrittweise und gestuft vorzugehen, mit Hilfe einer sogenannten „Angsthierarchie“. Es geht darum, sich nicht zu überfordern, sondern sich zu spüren und sozusagen sich selbst „mitzunehmen“, immer im Kontakt mit sich und gleichzeitig mit der Umgebung zu sein. Wir nennen das die Innen- und die Außenwahrnehmung. Übungen werden immer mit Wahrnehmungsübungen und Achtsamkeit begonnen. Dafür ist es wichtig, langsam vorzugehen und sich Zeit zu lassen. Dann werden in der Exposition die eigenen Befürchtungen „an der Realität“ überprüft.
Ein Beispiel: wenn ich Angst habe, beim Kaffeetrinken mit der Hand zu zittern, dann befürchte ich ja nicht das Zittern an sich, denn wenn es auftreten würde, wenn ich alleine zuhause Kaffee trinke, wäre es mir ja gleichgültig. Meine Befürchtung besteht also darin, was andere denken könnten, wenn ich zittere, dass sie mich entwerten oder kritisch sehen könnten. Sie könnten beispielsweise denken: die ist bestimmt Alkoholikerin. Oder: die Frau ist aber unsicher! Wie schlimm wäre es, wenn das andere denken würden und würden alle Menschen so denken, wenn ich zittere? Ich mache in der Expo meine Augen auf und schaue hin: wie gucken die anderen? Wie interessiert sind sie wirklich? Und bin ich so wichtig wie ich meine? Und selbst wenn: wie schlimm wäre es, wenn ich zitterte? Würden das alle anderen Menschen genau so sehen?
Das heißt also: die Expo hilft dabei, Angst abzubauen, wenn sie zugelassen wird bei gleichzeitigem Erlauben aller Gefühle und Umstrukturieren der hartnäckigen Grundüberzeugungen. Das jetzt mal wirklich ganz kurz zusammengefasst. Ich denke, dass es über die Exposition viele Missverständnisse gibt. Wie beispielsweise, dass das „reine“ Verhaltensübungen seien. Richtig ist aber, dass in diesen Übungen sowohl die Emotionen, als auch die Kognitionen mit angesprochen werden und dass Exposition eine ausgesprochen komplexe und wenn richtig durchgeführt sehr wirksame Methode ist.
Was ist Ihr „Erste-Hilfe-Satz“, den Betroffene sich sagen können, wenn sich die Phobie wieder meldet?
 Dass die Angst sich wieder meldet, heißt ja erst mal nichts weiter, als das sich der Betroffene vielleicht in einer Stresssituation befindet und sich zu viel zugemutet hat. Da ist es sicher gut, erst einmal zu analysieren, was eigentlich los ist, um dann zu schauen, wie man gegensteuern kann. Ich erkläre Angst erst einmal als ein Signal des Organismus. Für Menschen, die schon einmal eine Angststörung hatten, kann sie wie ein Signalfähnchen (grün, gelb, rot) darauf hinweisen, dass etwas aus dem Lot gerät und dann kann immer noch nachjustiert werden. Das heißt ja nicht, dass man einen „Rückfall“ hat. Ich unterscheide da zwischen „Vorfall“ und „Rückfall“. Das heißt also: die Angst gar nicht so ernst nehmen! Sie ist ein körperliches Signal und geht auch wieder vorbei. Jeder Mensch hat einmal Angst oder ist unsicher, das ist ganz normal. Also: Don‘t panic, es ist vielleicht gar nichts los. Wir sind nicht so wichtig (und auffällig!) wie wir meinen. Wahrscheinlich ist es niemandem aufgefallen, weswegen Sie sich jetzt in der einen oder anderen Situation schämen oder ängstigen. Ich mag den Satz von Arno Schmidt: „Schwamm drüber, wir sind doch alle nur Heinis.“
Dass die Angst sich wieder meldet, heißt ja erst mal nichts weiter, als das sich der Betroffene vielleicht in einer Stresssituation befindet und sich zu viel zugemutet hat. Da ist es sicher gut, erst einmal zu analysieren, was eigentlich los ist, um dann zu schauen, wie man gegensteuern kann. Ich erkläre Angst erst einmal als ein Signal des Organismus. Für Menschen, die schon einmal eine Angststörung hatten, kann sie wie ein Signalfähnchen (grün, gelb, rot) darauf hinweisen, dass etwas aus dem Lot gerät und dann kann immer noch nachjustiert werden. Das heißt ja nicht, dass man einen „Rückfall“ hat. Ich unterscheide da zwischen „Vorfall“ und „Rückfall“. Das heißt also: die Angst gar nicht so ernst nehmen! Sie ist ein körperliches Signal und geht auch wieder vorbei. Jeder Mensch hat einmal Angst oder ist unsicher, das ist ganz normal. Also: Don‘t panic, es ist vielleicht gar nichts los. Wir sind nicht so wichtig (und auffällig!) wie wir meinen. Wahrscheinlich ist es niemandem aufgefallen, weswegen Sie sich jetzt in der einen oder anderen Situation schämen oder ängstigen. Ich mag den Satz von Arno Schmidt: „Schwamm drüber, wir sind doch alle nur Heinis.“
Das Interview führte Simone Scheinert.

Dr. phil. Martina Fischer-Klepsch ist Psychologische Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie und Schematherapie in eigener Praxis in Hamburg. Zudem arbeitet sie in der Aus- und Weiterbildung als Supervisorin und Selbsterfahrungsleiterin. Weitere Infos unter: https://www.fischer-klepsch.de/

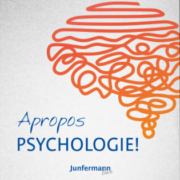

 © Galacticus (https://stock.adobe.com)
© Galacticus (https://stock.adobe.com)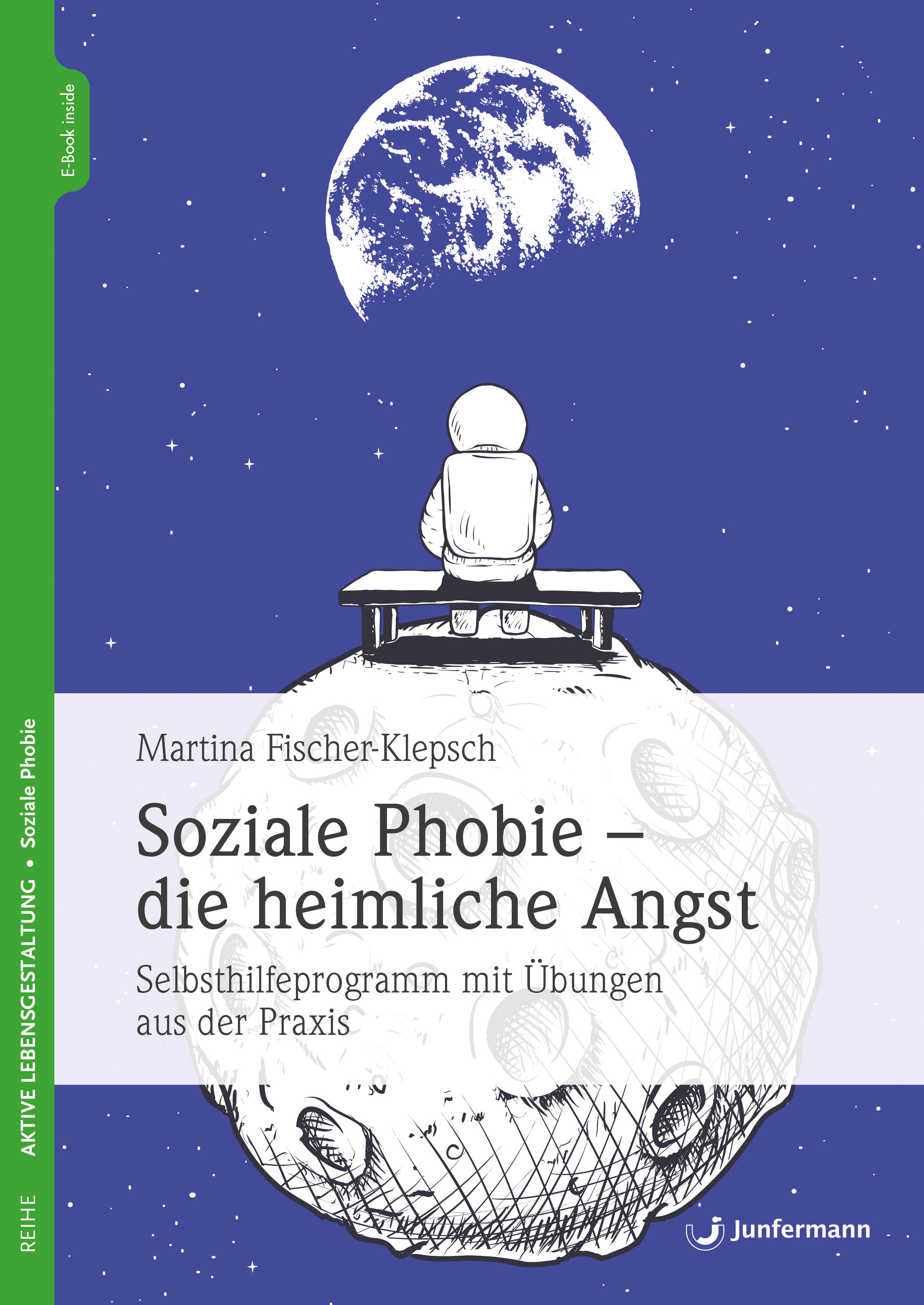 Es gibt wohl kaum einen Menschen, der nicht einmal Angst davor hat, sich zu blamieren, peinlich zu verhalten oder von anderen abgelehnt zu werden. Schüchternheit und leichte Formen von sozialer Unsicherheit sind sehr weit verbreitet. Die Momente von Unbehagen sind dabei zwar nicht angenehm, werden aber bald darauf wieder vergessen. Wenn die sozialen Ängste allerdings häufiger werden, wenn sie mit negativen Gedanken und Bewertungen der eigenen Person verbunden sind, und anfangen, das Leben zu beeinträchtigen, dann wird diese Unsicherheit zu einer Sozialen Phobie.
Es gibt wohl kaum einen Menschen, der nicht einmal Angst davor hat, sich zu blamieren, peinlich zu verhalten oder von anderen abgelehnt zu werden. Schüchternheit und leichte Formen von sozialer Unsicherheit sind sehr weit verbreitet. Die Momente von Unbehagen sind dabei zwar nicht angenehm, werden aber bald darauf wieder vergessen. Wenn die sozialen Ängste allerdings häufiger werden, wenn sie mit negativen Gedanken und Bewertungen der eigenen Person verbunden sind, und anfangen, das Leben zu beeinträchtigen, dann wird diese Unsicherheit zu einer Sozialen Phobie.